aus e-mail von Doris Pumphrey, 26. Januar 2025, 16:25 Uhr
Berliner Zeitung 26.1.2025
<https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/staatsnaehe-von-journalisten-der-oerr-schaufelt-sich-damit-sein-eigenes-grab-li.2290970>
*Staatsnähe von Journalisten: „Der ÖRR schaufelt sich damit sein eigenes
Grab“
*
/Ein Buch sorgt für Aufsehen: In „Inside Tagesschau“, vor wenigen Tagen
erschienen, rechnet der Journalist Alexander Teske mit der wichtigsten
Nachrichtensendung des Landes ab. Teske, 53, in Leipzig geboren, hat
sechs Jahre als Planer für die „Tagesschau“ gearbeitet. Die erste
Auflage des Buches, das sofort die Bestsellerlisten eroberte, ist
bereits vergriffen.
Wir dokumentieren hier das Kapitel, in dem der Autor die zweifelhafte
Nähe zwischen Journalisten und Politikern beleuchtet: „Von den Medien in
die Politik – und zurück“.
/
„Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung
ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der
Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer
Angebote zu berücksichtigen“, heißt es im Gesetz zum Staatsvertrag zur
Modernisierung der Medienordnung in Deutschland vom 8. September 2020.
Tun sie das wirklich? Ich scrolle am 18. Januar 2023 die
/tagesschau.de/-Seite durch. Das mache ich häufig zu Dienstbeginn der
Frühschicht. Erst einmal einen Überblick verschaffen. Danach sind die
Konkurrenzseiten dran: /Spiegel, Bild, Süddeutsche. Deutschlandfunk
/habe ich schon seit dem Aufstehen eine Stunde gehört.
Ich stoße auf eine „Analyse“ vom Vorabend. Michael Stempfle lobt darin
Boris Pistorius. Der Innenminister Niedersachsens mit SPD-Parteibuch
soll neuer Bundesverteidigungsminister werden. Die Dachzeile ist
ungewöhnlich: „Der Niedersachse ist ein Vollblutpolitiker und was er
tut, hat er sich gut überlegt.“
Im Text heißt es weiter, Pistorius sei ein Politiker-Typus „der anpackt
– mit einem sicheren Gespür für Themen und für pragmatische Lösungen“,
seine „Stimme hat Gewicht“, er sei „schlagfertig“, „selbstbewusst,
ehrgeizig“, „durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig“ sowie
„hartnäckig, wenn es um die Sache geht“ und „mit den großen Themen
vertraut“, kurz: für das Amt „hervorragend geeignet“. Der
Erwartungsdruck auf Pistorius sei zwar hoch, findet Stempfle, „und doch
dürften alle vorgewarnt sein, denn Pistorius weiß sich einzuarbeiten und
sich zu verteidigen“.
Im Hauptstadtstudio der /ARD /ist Stempfle für die innere Sicherheit
zuständig. Schon seit fast zehn Jahren. Dies verstößt gegen die
Gepflogenheiten. Korrespondenten werden von ihren Haussendern für einen
begrenzten Zeitraum entsandt. Es gilt drei plus zwei. Bedeutet: Der
Redakteur bekommt einen Vertrag für drei Jahre, der noch einmal um zwei
Jahre verlängert werden kann. Dann ist Schluss und man muss aus Berlin
wieder zurück zum Heimatsender.
Dies soll eine zu große Nähe zu Politikern verhindern. Denn man sieht
sich beinahe täglich. Es besteht die Gefahr, dass Redakteure sich selbst
als Teil des politischen Systems verstehen, ihre persönlichen
Beziehungen sie milde über die Akteure im Regierungsbezirk urteilen
lassen und sich ihr Blick auf Verfehlungen trübt.
Immer wieder verstößt die /ARD /gegen ihre Regeln. So berichtete der
/MDR/-Redakteur Tim Herden über 20 Jahre aus dem Hauptstadtstudio.
Kritische Distanz zu halten ist da nicht einfach. Später wurde Herden
Landesfunkhausdirektor in Sachsen-Anhalt.
Fünf Tage später gibt es morgens nur ein Thema bei /ARD-aktuell. /„Hast
du schon gehört? Michael Stempfle wird neuer Sprecher von Pistorius!“,
werde ich begrüßt. „Ach, das ist ja eine Überraschung. Aber auch nicht
ungewöhnlich. Was wird jetzt aus Thiels?“
Schon der bisherige Sprecher im Bundesverteidigungsministeriumkam aus
dem /ARD/-Hauptstadtstudio. Christian Thiels war Chef vom Dienst bei den
Tagesthemen und berichtete wie Stempfle für den /SWR /aus Berlin für das
Erste. Sein Spezialgebiet war die Verteidigung. Dann diente er erst
Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Christine Lamprecht als Sprecher.
Auch in der Konferenz um 10.30 Uhr ist die Personalie Stempfle Thema.
Vor allem seine „Analyse“ erscheint in einem neuen Licht. Die Reaktionen
außerhalb des Hauses sind entsprechend. So schreibt der Medienkritiker
Stefan Niggemeier auf Twitter: „In der vergangenen Woche hatte er bei
der ‚Tagesschau‘ schon eine Liebeserklärung an den neuen
Verteidigungsminister veröffentlicht. Wie schafft es so ein Text bei der
Tagesschau durch die Qualitätskontrolle?“
Ich denke: „Qualitätskontrolle? Welche Qualitätskontrolle?“ Der
Medienjournalist Marvin Schade verweist auf die „Analyse“ mit dem
Kommentar: „Sowas lässt solche Wechsel noch bitterer aussehen, als sie
ohnehin sind.“ Der /RBB/-Kollege Hanno Christ empfindet ähnlich:
„Einfach nur peinlich. Sage ich als /ARD/-Journalist. Geht gar nicht.“
Eine X-Userin stimmt in die Kritik ein: „Diese Kungelei zwischen Politik
und Medien ist ein Sargnagel der Demokratie.“ Ein weiterer X-User
richtet die Frage an die Tagesschau: „Wenn ein ARD-Journalist erst ein
gefälliges Stück über den designierten Verteidigungsminister schreibt
und dann dessen Sprecher wird, habt Ihr da kein Magengrummeln?“
Haben wir. Nach kurzer Diskussion, wie wir damit umgehen sollen,
schreiben wir unter den Artikel: „Anmerkung der Redaktion: Michael
Stempfle war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes (17.
Januar 2023) Korrespondent im /ARD/-Hauptstadtstudio. Seit dem 23.
Januar 2023 ist bekannt, dass er als Sprecher in das
Verteidigungsministerium wechselt.“
Wer das Bewerbungsschreiben Stempfles an Pistorius heute noch einmal
nachlesen möchte, sucht es vergeblich. Die /Tagesschau /hat den Link
deaktiviert. Abgesehen von dieser Löschaktion spuckt das Archiv von
/tagesschau/./de /unter dem Suchwort „Stempfle“ 60 Meldungen und 427
Videos aus, die vor seinem Wechsel entstanden. Stempfle war also nicht
irgendwer, sondern eine tragende Säule in der Berichterstattung der
/Tagesschau/.
*Boris Pistorius und die Stempfle-Affäre
*
So fragt denn auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer auf X:
„Kürzlich noch überschwänglich Boris Pistorius bejubelt und schon wird
Stempfle sein Sprecher. Sicherlich klärt uns Stempfle auf, ob das
Jobangebot zum Zeitpunkt des Kommentars schon vorlag!?“
Stempfle verteidigt sich im Medienmagazin /DWDL/. Das Gespräch mit
Pistorius habe am Donnerstagabend stattgefunden. Den Artikel habe er
zuvor geschrieben, er sei am Donnerstag um 18.48 Uhr online gegangen. Am
Samstag sei er dann eingestellt worden. Am Montag habe er die /ARD
/informiert.
Demnach wäre das sehr schnell gegangen. Meine Erfahrungen mit
Personalentscheidungen innerhalb der /ARD/: Sie dauern Wochen, manchmal
länger. Als ich beim /MDR /meinen ersten Arbeitstag als festangestellter
Redakteur hatte, lag noch nicht einmal ein unterschriebener
Arbeitsvertrag vor, obwohl mein Bewerbungsgespräch Monate zurücklag.
Auch mein Wechsel zur /Tagesschau /wurde ein halbes Jahr zuvor eingefädelt.
Stempfle hat den fraglichen Artikel am 17. Januar geschrieben, am 19.
Januar soll er das Angebot bekommen haben, am 23. Januar hat er die /ARD
/informiert und noch am selben Tag auf X seinen Profiltext geändert. Er
sei jetzt Sprecher von Pistorius und nicht mehr /ARD/-Journalist. Und
ich dachte immer: Es gibt Kündigungsfristen, an die sich jeder zu halten
hat?
Stempfle ist ein Beispiel. Schon zu /MDR/-Zeiten sah ich reihenweise
Kollegen in Dresden in die Landespolitik wechseln. Sie tauschten ihren
Schreibtisch in der Redaktion gegen einen im Ministerium. Florian
Schäfer wurde Sprecher des FDP-geführten Wirtschaftsministeriums, Frank
Wend Pressechef im CDU-geleiteten Innenministerium und Annett Hofmann
bekam den Posten als Pressesprecherin im Ministerium für Wissenschaft
und Kunst, ehe sie später den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer
heiratete.
In meiner Zeit im Hauptstadtstudio staunte ich immer, wie oft Kollegen
des /Bayerischen Rundfunks /Sprecher in CSU-Ministerien wurden. Gern im
Bundesverkehrsministerium. Oft waren die Kollegen sehr jung. Wie
Sebastian Rudolph. Mit 32 beförderte Peter Ramsauer ihn zu seinem
Sprecher und zum Leiter der Kommunikationsabteilung des
Bundesverkehrsministeriums.
*Steffen Seibert: Vom ZDF-Journalisten zum Regierungssprecher
*Oft sind die Fälle prominenter. Wie der von Steffen Seibert. 21 Jahre
berichtete er für das /ZDF/, moderierte zuletzt drei Jahre lang das
/heute journal/, ehe er 2010 Regierungssprecher Angela Merkels wurde.
Sinnigerweise übernahm er das Amt von Ulrich Wilhelm. Der hatte 1983 bis
1990 als freier Mitarbeiter für den Hörfunk und das Fernsehen des
/Bayerischen Rundfunks /gearbeitet, bevor er ins Pressereferat des
bayerischen Innenministeriums wechselte. Über die Station Pressechef der
Staatskanzlei von Edmund Stoiber wechselte er 2005 als
Regierungssprecher von Bundeskanzlerin Merkel und damit als verbeamteter
Staatssekretär nach Berlin. Und kehrte nach dem Antritt von Seibert zum
BR zurück: als Intendant.
Wellen schlug auch der Fall von Ulrike Demmer. Sie begann als freie
Journalistin für /ZDF/, /RBB/, /Spiegel /und /Focus/, bevor sie das
Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland leitete. 2016 wurde
sie auf Vorschlag von Sigmar Gabriel stellvertretende
Regierungssprecherin im Range einer Ministerialdirektorin. Fünf Jahre
lang vertrat sie die Haltung der schwarz-roten Regierung. Im Juni 2023
wurde sie dann zur Intendantin des /RBB /gewählt, den sie seit dem 1.
September 2023 leitet. An der Börse gibt es das Sprichwort: „Hin und her
macht Taschen leer.“ Im Journalismus müsste es heißen: „Hin und her
bringt immer mehr.“
Demmers Wahl zur /RBB/-Intendantin sei ein Fehler, kommentiert Georg
Löwisch in der /ZEIT/: „Damit beschädigt der Rundfunkrat die
öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt … Sie arbeitete als Sprachrohr
der Regierung … Und /ARD /und /ZDF /können es sich nicht leisten, auch
nur an irgendeiner Stelle mit den Regierungsapparaten verwechselt zu
werden. Die Unterscheidung zwischen Staatsfunk und
öffentlich-rechtlichem Fernsehen mag beckmesserisch klingen, doch sie
ist existenziell … Von der Wahl geht auch in die Redaktionen von /ARD
/und /ZDF /ein ungutes Signal aus: Legt man sich heute mit dem
Regierungssprecher an, wenn der morgen Senderchef sein kann?
Journalisten und Pressesprecher sind keine Kollegen, sie stehen auf
unterschiedlichen Seiten. Eine Drehtür zwischen Sendern und Staat darf
es nicht geben.“
*Ulla Fiebig: Redakteurin, Pressereferentin, Landessenderdirektorin
*Weniger spektakulär, aber nicht weniger interessant sind die Fälle Ulla
Fiebig und Christiane Wirtz. Fiebig arbeitete 19 Jahre als Redakteurin
für den /SWR/, zuletzt im Hauptstadtstudio der /ARD /mit den
Schwerpunkten Justiz und Verbraucherschutz. Dann wechselte sie 2018 die
Seiten und übernahm das Pressereferat im Bundesfamilienministerium von
Franziska Giffey, SPD. Nach vier Jahren kehrte sie in die
öffentlich-rechtlichen Senderarme zurück – als Landessenderdirektorin
des /SWR /für Rheinland-Pfalz.
Wirtz betrieb das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel besonders erfolgreich: Sie
begann bei der /Süddeutschen Zeitung/, bevor sie PR-Frau wurde – als
stellvertretende Sprecherin im Bundesjustizministerium. Danach kehrte
sie in den Journalismus zurück – zum /Deutschlandfunk/. Hier wurde sie
Leiterin der Innenpolitik. Eine Position, die sie drei Jahre lang
ausübte, ehe sie 2014 erneut die Seiten wechselte und stellvertretende
Sprecherin der Bundesregierung wurde. 2016 ging sie richtig in die
Politik: als verbeamtete Staatssekretärin ins Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz. Ihren Arbeitsvertrag beim Deutschlandfunk kündigte
sie nicht. Wie auch Steffen Seibert seinen Arbeitsvertrag beim /ZDF /nur
ruhen ließ.
/Spiegel Online /empörte sich darüber: »Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk steht schon lange im Verdacht, unter der Fuchtel der Politik zu
stehen, seit dem Jahr 2013 wird er zudem mit einer steuerähnlichen
Zwangsabgabe finanziert. Nun stellt sich auch noch heraus, dass er ein
sicherer Hafen ist für Journalisten, die einmal einen Ausflug in die
Politik wagen.
Es gibt schon finanziell keinen Grund für das Rückkehrrecht von Seibert
und Wirtz. Scheidet ein beamteter Staatssekretär nach einem
Regierungswechsel aus, wird er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.
Nach dem Beamtenversorgungsgesetz gut versorgt: In den ersten drei
Monaten erhalten politische Beamte das volle Gehalt weiter, danach
beziehen sie ein ansehnliches ‚Ruhegehalt‘.«
Es ist genau dieses Rückkehrrecht, welches in der Kritik steht. Der
Redakteur wechselt den Arbeitsplatz, sein alter wird ihm aber jahrelang
warmgehalten. Falls es im neuen nicht funktioniert, darf er zum alten
Arbeitgeber zurückkommen. Der Arbeitsvertrag bei /NDR/, /ZDF /oder
/Deutschlandradio /ruht lediglich. In der freien Wirtschaft dürfte das
die absolute Ausnahme sein. So teilt ein Sprecher der Bild mit: „Bei
Axel Springer gibt es grundsätzlich kein Rückkehrrecht.“ Im ÖRR ist das
Rückkehrrecht dagegen die Regel.
Auch der Medienwissenschaftler Thomas Koch von der Universität Mainz
findet den Drehtüreffekt problematisch: „Wenn Personen, die lange in der
Politik oder der Wirtschaft gearbeitet haben, dann wieder unabhängig
berichten sollen, wird die Idee des Journalismus, möglichst unabhängig
und objektiv berichten zu können, sehr erschwert.“
*Anna Engelke: Vom NDR ins Schloss Bellevue und wieder zurück zum NDR
*Benno Viererbl hat, ebenfalls an der Universität Mainz, Journalisten zu
den Motiven für ihren Berufswechsel befragt. Karriereentwicklung ist ein
Grund. „Ich habe das Gefühl, dass Rollenwechsel zunehmen, auch weil die
Beschäftigungsverhältnisse im Journalismus prekärer geworden sind. Da
erscheint PR oft attraktiver und besser vergütet. Je unattraktiver das
Berufsumfeld wird, umso größer wird das Problem für den Journalismus.
Denn der PR-Job kollidiert mit dem Wertesystem eines Journalisten.
Deswegen finde ich die mehrmaligen Wechsel problematisch. Diese
vermeintliche Nähe stößt bei Außenstehenden auf Unverständnis. Vor allem
das Rückkehrrecht sehe ich kritisch. Was gar nicht geht, ist seinen
ehemaligen Chef oder seine Parteifreunde zu interviewen, denn natürlich
bestehen da noch freundschaftliche Kontakte.“
Der jüngste Fall ist der von Anna Engelke. Sie war Sprecherin von
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD, 2017 vom /NDR /gekommen.
Bis 2022 leitete sie die Pressearbeit im Schloss Bellevue, ehe sie ihr
Rückkehrrecht zum /NDR /wahrnahm.
Hier wurde sie Co-Gastgeberin des Podcast „Strategie und Streitkräfte“.
Den durfte sie ein Jahr und neun Monate lang von Berlin aus moderieren.
Was äußerst ungewöhnlich ist, wenn sowohl Sender als auch Podcast in
Hamburg beheimatet sind.
Am 23. Februar 2023 sprach sie einen Kommentar zum Krieg in der Ukraine
und zu den deutschen Waffenlieferungen für /NDR info/. Angekündigt wurde
Anna Engelke als „Verteidigungsexpertin“. Eine erstaunliche Karriere für
eine Frau, die zuvor fünf Jahre lang Sprecherin des Bundespräsidenten
war, der zu politischer Unabhängigkeit und Ausgleich angehalten ist.
Im Juli 2024 übernahm Engelke dann die stellvertretende Leitung des
/ARD/-Hauptstadtstudios und moderiert seitdem auch den /Bericht aus
Berlin/. Die Co-Moderation eines Podcast war nicht der geeignete
Karrieresprung für die Ex-Sprecherin des Bundespräsidenten – die Leitung
des /ARD/-Hauptstadtstudios schon eher.
Man darf annehmen, dass Engelke aus ihrer Sprecherzeit bei Steinmeier
nicht nur seine Handynummer besitzt, sondern auch die von weiteren
Spitzenpolitikern. Zudem darf man vermuten, dass sie zu diesen ein enges
Verhältnis pflegte. Dies wird sie in neuer Funktion nicht von einem Tag
auf den anderen auf Eis legen. Wie wird sie ihren alten Chef ansprechen,
wenn sie ihn im /Bericht aus Berlin/, einem /Brennpunkt /oder einer
anderen /ARD/-Sondersendung interviewen muss? „Du, Walter?“ Und alle die
anderen? „Lieber Olaf? Lieber Wolfgang? Lieber Lars?“ Oder tun sie dann
alle ganz förmlich? Wie unbefangen können solche Interviews ablaufen?
Wie politisch unbelastet können die Themenvorschläge, die Kommentare
oder die Abnahme durch Engelke sein?
„Seitenwechsel wie diese werden in der Debatte um den ÖRR gern als Beleg
für eine zu große Nähe zwischen öffentlich-rechtlichen Journalist:innen
und der Politik angeführt“, kritisiert daraufhin selbst das /NDR/-eigene
Medienmagazin /ZAPP /auf X.
Die Berliner Zeitung schreibt dazu: „An der journalistischen
Unabhängigkeit der leitenden Personen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
soll bitte kein Zweifel bestehen. Wer’s glaubt, wird selig. Und wer
nicht, zahlt trotzdem Rundfunkbeitrag.“
Und der Medienethiker Christian Schicha sagt: „Ich kann die Kritik auf
jeden Fall nachvollziehen, weil dieses Hin-und-her-Springen zwischen
einem politischen Amt und der journalistischen Tätigkeit sicherlich
denjenigen Vorschub gibt, die sagen: Also wir haben so etwas wie
Staatsmedien, Staatsfernsehen. Die Abgrenzung ist nicht da – eigentlich
sollten die Journalistinnen und Journalisten ja die Mächtigen
kontrollieren und wenn da solche Verbindungen sind, hat das sicherlich
ein Geschmäckle.“
Mit dem Springen vom PR-Job eines Unternehmenssprechers in die Rolle
eines unabhängigen Journalisten, der objektiv berichtet, und zurück
haben einige Redakteure ohnehin keine Bauchschmerzen. Julia Krittian
berichtete aus dem /ARD/-Hauptstadtstudio, bevor sie /MDR/-Sprecherin
und dann Chefredakteurin des /MDR /wurde. Annette Leiterer war
Redaktionsleiterin von /ZAPP /und ist heute Leiterin der Kommunikation
des /NDR/. Dabei sind PR und Journalismus zwei verschiedene
Berufsfelder. Niemand würde auf die Idee kommen, die Juristische
Direktorin oder die Verwaltungschefin zur Chefredakteurin zu küren.
Immer wieder ist der Aufschrei groß, wenn ein aktueller Fall bekannt
wird. Nach einigen Tagen legt sich der aufgewirbelte Staub und alles
bleibt, wie es ist. Der ÖRR schaufelt sich damit Stück für Stück sein
eigenes Grab. Denn der Eindruck der Verflechtung von Politik und Medien
verschärft sich mit jedem Seitenwechsler.
Es liegt nicht in der Macht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, einem
neuen Job eines Mitarbeiters im Wege zu stehen. Aber die gängige Praxis,
Arbeitsverträge ruhen zu lassen, könnte sofort beendet werden.
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.








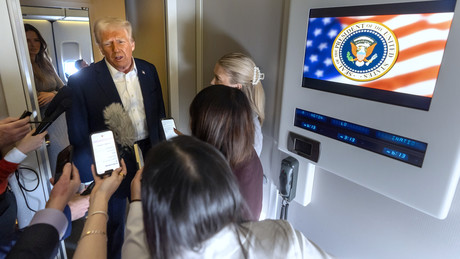 Quelle: AP © Mark Schiefelbei
Quelle: AP © Mark Schiefelbei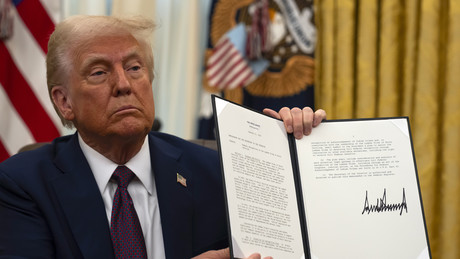


 Quelle: www.globallookpress.com © Al Drago - Pool via CNP
Quelle: www.globallookpress.com © Al Drago - Pool via CNP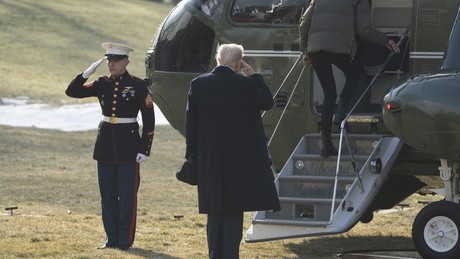

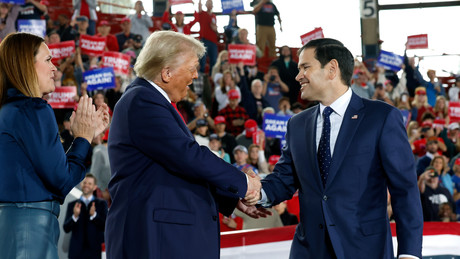

 Quelle: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld (Screenshot)
Quelle: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld (Screenshot)


 Quelle: AP © Alex Brandon
Quelle: AP © Alex Brandon