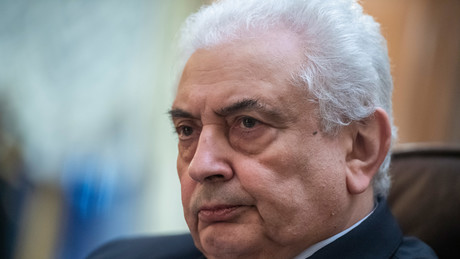----- Original Message --------
Subject: 1. n tv: Ukraine-Ticker 2. Euronewls: Putin spricht von "echtem
Krieg" in der Ukraine bei Parade ohne Flugschau u.a.
Date: 10.05.2023 19:02
From: Clemens Ronnefeldt <c.ronnefeldt@t-online.de>
To:
Liebe Friedensinteressierte,
nachfolgend einige Beiträge zum Ukraine-Krieg:
1. n tv: Ukraine-Ticker
2. EURONEWLS: PUTIN SPRICHT VON "ECHTEM KRIEG" IN DER UKRAINE BEI PARADE
OHNE FLUGSCHAU
3. SZ: KRIEG: GEGENOFFENSIVE BEGINNT WEIT HINTER DER RUSSISCHEN FRONT
4. DIE ZEIT: PENTAGON-LEAKS: US-GEHEIMDIENSTE ÜBERWACHTEN WOMÖGLICH
BUNDESMINISTERIUM
5. HANDELSBLATT: MUNITION FÜR DIE UKRAINE - EU-KOMMISSION SCHWÖRT
RÜSTUNGSFIRMEN AUF „KRIEGSWIRTSCHAFT“ EIN
6. Fischerverlag: H. Welzer und L. Keller: Eine Inhaltsanalyse der
deutschen Medienberichterstattung zum Ukrainekrieg.
7. ipg: Oleksandr Kraiev: Der Streit um Getreide zeigt, die Solidarität
mit der Ukraine reicht nur bis ans eigene Feld.
8. Dr. Thomas Roithner: Zweite Chance für echte Friedens-EU
9. ZDK: ZURÜCK AN DEN VERHANDLUNGSTISCH“: ZDK-VOLLVERSAMMLUNG
DISKUTIERT VISIONEN FÜR DIE UKRAINE
10. MAY-MAY MEIJER UND KLAUS MOEGLING: FORDERUNG NACH MEHR UND NEUER
DIPLOMATIE: FÜR EINEN WAFFENSTILLSTAND UND DEN FRIEDEN IN DER UKRAINE
11. CONNECTION: E-MAIL-AKTION: SCHUTZ FÜR KRIEGSDIENSTVERWEIGERER AUS
RUSSLAND, BELARUS UND DER UKRAINE EINFORDERN
12. IN EIGENER SACHE: VERSÖHNUNGSBUND: STELLENAUSSCHREIBUNG: LEITUNG
DER GESCHÄFTSSTELLE
——
1. n tv: Ukraine-Ticker
https://www.n-tv.de/politik/16-51-Saenger-Alexander-Rosenbaum-verteidigt-inhaftierte-Kuenstlerinnen-bei-Konzert-in-St-Petersburg--article23143824.html
10.5.2023
(…)
15:42 Haftstrafe für russische Soldaten
Zwei russische Soldaten sind Menschenrechtlern zufolge zu je
zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil sie nicht in der
Ukraine kämpfen wollen. Ein Militärgericht in der Region Kamtschatka
im Fernen Osten habe die Strafen gegen Alexander Stepanow und Andrej
Michailow bereits Ende April verhängt, teilt die Organisation OVD-Info
mit.
Sie hätten sich dem Befehl widersetzt, in Kriegszeiten in den
Kampf zu ziehen. Russland hatte 2022 die Höchststrafe für ein solches
Vergehen auf bis zu drei Jahre angehoben. Den Angaben zufolge wurden
die beiden Männer zunächst nicht in ein Gefängnis überstellt. Sie
können zudem Berufung gegen das Urteil einlegen.
(…)
14:27 Putin bereitet Russlands Austritt aus KSE-Vertrag vor
Russland bereitet den offiziellen Austritt aus dem Abrüstungsvertrag
über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) vor. Das geht
aus einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin hervor, die der Kreml
kürzlich veröffentlicht hat. Dort wird Vizeaußenminister Sergej
Rjabkow zum Bevollmächtigten bei der Debatte im Parlament ernannt.
Das Gesetzesprojekt über den Austritt selbst ging noch nicht in der
russischen Staatsduma ein. Der KSE-Vertrag legt die Obergrenzen für
die Stationierung schwerer Waffen auf dem europäischen Kontinent fest.
(…)
23:08 Britischer Minister: Vermittlerrolle Chinas in Ukraine
wünschenswert
Eine chinesische Vermittlerrolle für einen Friedensschluss in der
Ukraine wäre nach Ansicht Londons wünschenswert. Das sagt der
britische Außenminister James Cleverly während eines Besuchs in den
USA. Chinas Präsident Xi Jinping könne sein "erhebliches Maß an
Einfluss" auf den russischen Staatschef Wladimir Putin nutzen, um
einen „gerechten und dauerhaften“ Friedensschluss herbeizuführen,
sagt
Cleverly bei einer Veranstaltung der US-Denkfabrik Atlantic Council.
Wenn eine solche Intervention Chinas helfe, die Souveränität der
Ukraine wieder herzustellen und den Abzug russischer Truppen bewirke,
habe er daran nichts auszusetzen, so er konservative britische
Politiker weiter.
-------------
2. EURONEWLS: PUTIN SPRICHT VON "ECHTEM KRIEG" IN DER UKRAINE BEI PARADE
OHNE FLUGSCHAU
https://de.euronews.com/2023/05/09/putin-spricht-von-echtem-krieg-in-der-ukraine-bei-parade-mit-8000-soldaten
Russland
PUTIN SPRICHT VON "ECHTEM KRIEG" IN DER UKRAINE BEI PARADE OHNE
FLUGSCHAU
Von Euronews mit dpa, AP
Zuletzt aktualisiert: 09/05/2023 - 18:19
Am sogenannten "Tag des Sieges" in Russland hat Präsident Wladimir
Putin davon gesprochen, dass gegen das "Vaterland ein Krieg
entfesselt" worden sei.
Auf dem Roten Platz in Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin
in seiner Rede den Krieg gegen das Nachbarland Ukraine gerechtfertigt.
Entgegen der bisherigen Regel, dass der Krieg in der Ukraine in
Russland als "militärische Spezialoperation" bezeichnet werden musste,
benutzte der Staatschef selbst das Wort Krieg.
Putin sagte: "Gegen unser Vaterland ist ein echter Krieg entfesselt
worden." Russland habe "den internationalen Terrorismus abgewehrt".
Und er versprach, die Menschen im Donbass zu beschützen. (…)
————————————
3. SZ: KRIEG: GEGENOFFENSIVE BEGINNT WEIT HINTER DER RUSSISCHEN FRONT
https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-gegenoffensive-beginnt-weit-hinter-der-russischen-front-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230504-99-562478
KRIEG: GEGENOFFENSIVE BEGINNT WEIT HINTER DER RUSSISCHEN FRONT
4. Mai 2023, 18:21 Uhr
Saporischschja (dpa) - Während viele Beobachter im Westen auf die
große Panzerschlacht in der Ukraine warten, deutet vieles darauf hin,
dass die lang angekündigte Gegenoffensive bereits an ganz anderer
Stelle begonnen hat. Eine beispiellose Serie von Drohnen- und
Sabotageangriffen trifft derzeit den Südwesten Russlands und die von
Moskau besetzten Gebiete der Ukraine. (…)
Militärökonom: Zweite Phase der Offensive
Laut dem deutschen Militärökonom Marcus Keupp hat damit die zweite
Phase der Offensive nach der Aufklärung der Schwachstellen etwa durch
Satellitenbilder begonnen. Mit Artillerie- und Drohnenfeuer werde im
Hinterland die Versorgung der feindlichen Truppen unterbrochen.
Erst in der dritten Phase gehe es darum, die massiven Wehranlagen der
Russen, die sie in den besetzten Gebieten der Ukraine nahe der Front
errichtet haben, zu zerstören, um dann mit Panzern vorzurücken. "Das
heißt also, das wird der Abschluss sein, nicht der Beginn", sagte er
im Deutschlandfunk.
Allgemein wird der Hauptstoß der ukrainischen Armee im Gebiet
Saporischschja in Richtung Tokmak und dann weiter nach Melitopol und
zum Asowschen Meer erwartet. Damit soll ein Keil zwischen die
russischen Truppen getrieben und die Krim von der Landbrücke nach
Russland abgetrennt werden.
Der Exilbürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, berichtet fast
täglich von ukrainischen Raketenschlägen gegen Depots und
Kommandozentralen der russischen Armee in der Region. Teilweise
bestätigen die Besatzungsbehörden das.
Ukrainische Einheiten testeten auch bereits mehrfach zwischen Orechiw
und Huljajpole die Stärke der massiv ausgebauten russischen
Verteidigungslinien. (…)
Es gibt aber auch Gerüchte um eine Fortsetzung der Herbstoffensive im
Norden im Luhansker Gebiet oder gar einen Angriff auf russisches
Gebiet nach Belgorod, um dies dann anschließend gegen ukrainische
Gebiete zu tauschen. Die wilden Spekulationen zeugen davon, dass
zumindest die Geheimhaltung bisher auf Kiewer Seite gut geklappt hat.
Trotzdem ist zumindest Keupp davon überzeugt, dass es Richtung Süden
geht. Ziel sei es für Kiew, die Krim zurückzuerobern. Dafür müsste
die
ukrainische Armee zu einer Stelle an der Küste vorstoßen, von wo aus
dann alle Ziele auf der Halbinsel mit Drohnen und
Langstrecken-Artillerie erreichbar wären. (…)
——
4. DIE ZEIT: PENTAGON-LEAKS: US-GEHEIMDIENSTE ÜBERWACHTEN WOMÖGLICH
BUNDESMINISTERIUM
https://www.zeit.de/politik/2023-04/pentagon-leaks-ueberwachung-bundesverteidigungsministerium
PENTAGON-LEAKS: US-GEHEIMDIENSTE ÜBERWACHTEN WOMÖGLICH
BUNDESMINISTERIUM
Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums empfangen Chinesen zu
Gesprächen –
und die Amerikaner kennen alle Details. Werden deutsche Behörden
gezielt ausgespäht?
Von Holger Stark
Aktualisiert am 28. April 2023, 11:40 Uhr
Siehe dazu:
https://www.ardmediathek.de/video/kontraste/kontraste-vom-27-04-2023/das-erste/Y3JpZDovL3JiYl9jNjU5MTkzYi1kNzM3LTQ5NDItOTZmYS1lZWE3Y2ZhNGE1N2FfcHVibGljYXRpb24
----------
5. HANDELSBLATT: MUNITION FÜR DIE UKRAINE - EU-KOMMISSION SCHWÖRT
RÜSTUNGSFIRMEN AUF „KRIEGSWIRTSCHAFT“ EIN
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/munition-fuer-die-ukraine-eu-kommission-schwoert-ruestungsfirmen-auf-kriegswirtschaft-ein-/29129076.html
MUNITION FÜR DIE UKRAINE
EU-KOMMISSION SCHWÖRT RÜSTUNGSFIRMEN AUF „KRIEGSWIRTSCHAFT“ EIN
Industriekommissar Breton will die Munitionsproduktion in Europa mit
Milliardensubventionen ankurbeln. Zur Not will er Unternehmen auch
zwingen, ihre Exporte umzuleiten.
04.05.2023 - 11:27 Uhr
Brüssel. Die EU-Kommission will die Versorgung der Ukraine mit
Munition
langfristig sicherstellen. Binnen zwölf Monaten sollen europäische
Rüstungsfirmen mindestens eine Million Schuss Artilleriemunition pro
Jahr produzieren.
Dafür stellt die Kommission 500 Millionen Euro aus ihrem Haushalt
bereit.
Die gleiche Summe soll von den Mitgliedstaaten kommen, sodass insgesamt
eine Milliarde Euro an Subventionen zur Verfügung steht.
Industriekommissar Thierry Breton gab sich am Mittwoch kämpferisch.
„Wir müssen in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln“, sagte er
bei
der Vorstellung des „Act in Support of Ammunition Production“ (ASAP)
in Brüssel. „Wir können dies tun, und wir werden dies tun.“ (…)
————————
6. Fischerverlag: H. Welzer und L. Keller:
Eine Inhaltsanalyse der deutschen Medienberichterstattung zum
Ukrainekrieg.
https://www.fischerverlage.de/magazin/neue-rundschau/die-veroeffentlichte-meinung
Neue Rundschau
DIE VERÖFFENTLICHTE MEINUNG
Eine Inhaltsanalyse der deutschen Medienberichterstattung zum
Ukrainekrieg.
Ein Artikel von Harald Welzer und Leo Keller.
(…)
Es findet eine Komplexitätsreduktion zugunsten von eindeutigen
Pro- und Kontra-Haltungen statt.
Auch dieser Sachverhalt steht in Widerspruch zu der schon erwähnten
Aufgabe des Journalismus, die informationelle Landschaft ausgewogen
und differenziert auszumessen und dabei möglichst viele Perspektiven
zur Geltung zu bringen, damit die Rezipienten sich gut begründete
Meinungen zum Geschehen bilden können.
Dabei ist es auch eine Aufgabe der Medien, die Auffassungen in
unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft gerade zu krisenhaften und
konsequenzenreichen Geschehnissen angemessen zur Geltung zu bringen.
Dies gilt zumal für Krisen, die mit Gewalt und Eskalationsrisiken
einhergehen – gerade da wäre es verantwortungsvoll, ein möglichst
breites Spektrum von Beobachtungen, Analysen und Einschätzungen zu
liefern und bestimmte Perspektiven nicht von vornherein abzuwerten
oder gar nicht zu berücksichtigen.
So wäre etwa eine gesellschaftliche Stimmungslage, in der die
Forderung von verstärkten Waffenlieferungen mit kleinen Schwankungen
über die gesamte Kriegszeit von etwa der Hälfte der Bevölkerung
unterstützt und von der anderen Hälfte abgelehnt wird, in den
Leitmedien mindestens grob abzubilden.
Das bedeutet auch die qualifizierte Darstellung von Chancen und
Risiken politischer Entscheidungen, deren Bewertung ja erst in der
Bevölkerung zu Zustimmung oder Ablehnung führt. Sollte das nicht der
Fall sein, könnte man sagen, erfüllen die Medien ihre Rolle in der
Demokratie nicht angemessen.
Dass eine solche Vereinseitigung der Perspektive auf den Krieg in dem
Buch Die vierte Gewalt von Richard David Precht und einem der beiden
Autoren2 dieses Textes behauptet wurde, ja, dass eine starke
Diskrepanz zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung
herrsche, führte im vergangenen Herbst zu einiger Aufregung, zumal der
empirische Beleg für diese These damals noch ausstand, wie nicht zu
Unrecht moniert wurde.
Der kann nun nachgeliefert werden, und zwar gleich doppelt. Zum einen
ist gerade eine klassisch inhaltsanalytische Untersuchung der
Berichterstattung und Kommentierung in den acht Leitmedien (FAZ,
Süddeutsche Zeitung, Bild, Spiegel, Zeit, ARD Tagesschau [20 Uhr], ZDF
heute [19 Uhr], RTL Aktuell [18 : 45]) durch eine Forschungsgruppe um
Markus Maurer von der Uni Mainz erschienen, die aber lediglich einen
Untersuchungszeitraum vom 24. 2. bis 31. 5. 2022 umfasst; die
Otto-Brenner-Stiftung hat den Endbericht am 18. 2. 2023
veröffentlicht.
Diese Leitmedien haben auch wir untersucht, aber wir können unsere
folgenden Aussagen in Bezug auf den viel längeren Zeitraum vom 1. 2.
2022 bis zum 31. 1. 2023 machen. Unsere empirische Grundlage umfasst
107 000 Texte, die zum Thema »Krieg in der Ukraine« in den Leitmedien
über diese Periode hinweg publiziert wurden (…)
———
7. ipg: Oleksandr Kraiev: Der Streit um Getreide zeigt, die Solidarität
mit der Ukraine reicht nur bis ans eigene Feld.
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/zermahlt-6687/?utm_campaign=de_40_20230509&utm_medium=email&utm_source=newsletter
Europäische Integration
09.05.2023
Oleksandr Kraiev
Oleksandr Kraiev ist Direktor des Nordamerikaprogramms beim
ukrainischen Prism Foreign Policy Council und Direktor des
Forschungsprogramms für den transatlantischen Dialog und die
NATO-Beziehungen der Strategic and Security Studios Group.
Er lehrt internationale Politik am Institut für internationale
Beziehungen (IMO
KNU) und an der Kiew-Mohyla-Akademie (NaUKMA). Zermahlen
Der Streit um Getreide zeigt, die Solidarität mit der Ukraine reicht
nur bis ans eigene Feld.
Was Kiew und Brüssel daraus lernen müssen.
(…)
Während 2021 nur 30 Prozent der Ausfuhren in europäische Länder
geliefert wurden, waren laut der Comtrade-Datenbank der UN 2022 sieben
der zehn wichtigsten Abnehmerländer europäische Staaten. Länder wie
Indonesien, Iran, Pakistan, Marokko und Tunesien flogen aus den Top
Ten. Auch die zwei bis dato größten Abnehmerstaaten, China und
Ägypten, reduzierten ihre Importe stark.
In Rumänien, Polen, Ungarn und der Slowakei kam es dadurch zu
dramatischen Veränderungen auf dem Getreidemarkt. In allen Ländern
dieser Region sind die Getreideimporte aus der Ukraine astronomisch
gestiegen.
In Rumänien stieg das Volumen beispielsweise von zwei Millionen auf
fast 1,3 Milliarden US-Dollar. Ähnlich hohe Zuwachsraten
verzeichneten Polen (von 14 auf 646 Millionen US-Dollar), Ungarn (von
acht auf 401 Millionen US-Dollar) und die Slowakei (von null auf 116
Millionen US-Dollar).
Nachdem die Getreidespeicher in diesen Ländern ihre Belastungsgrenze
erreicht hatten – wobei die einheimischen Erzeugerinnen und Erzeuger
aufgrund der Getreidelieferungen sogar ihre eigenen Getreidespeicher
mancherorts nicht mehr nutzen konnten – stoppten sie die
Getreidelieferungen aus der Ukraine und auch den Transit durch ihr
Staatsgebiet. Die Einigung der EU-Kommissionbeendet nun diese
Maßnahmen – im Gegenzug werden für Weizen, Mais, Raps und
Sonnenblumenkerne aus diesen Ländern außergewöhnliche
Schutzmaßnahmen eingerichtet.
Dass diese Krise durch die Weigerung ausgelöst wurde, die
Getreidelieferungen in entferntere Teile Afrikas umzulenken, fand in
den Verlautbarungen dieser Länder weitaus weniger Erwähnung. Zugleich
sollte nicht vergessen werden, dass die europäischen Länder an den
ukrainischen Lieferungen weiterhin gut verdient haben. (…)
Was lässt sich gegen das entstandene Chaos unternehmen? Erstens müssen
unbedingt günstige Rahmenbedingungen für den Transit geschaffen
werden: ein konkreter Kontrollmechanismus, der dafür sorgt, dass die
Agrarerzeugnisse aus der Ukraine nicht in Europa „hängenbleiben“,
sondern weitergeleitet werden, zum Beispiel auf die afrikanischen
Märkte.
Auf diese Weise ließen sich unnötige Belastungen der Landwirte und der
Infrastruktur der mitteleuropäischen Länder vermeiden. Erste Schritte
in diese Richtung wurden bereits in die Wege geleitet: Die Ukraine
plant, denjenigen Unternehmen, die Getreide in Polen entladen wollen,
den Getreideexport für eine Weile zu untersagen.
Der zweite wichtige Aspekt sind Beihilfen für die einheimischen
Landwirte. Es wird häufig gewitzelt, die Europäische Union sei ein
kollektiver Unterstützungsmechanismus für die französischen Bauern.
Dass die Subventionsregeln auf den Prüfstand gestellt werden und die
Länder Mitteleuropas dabei mehr Gewicht bekommen sollten, ist seit
Langem überfällig.
Durch die Einschränkung der Importe aus der Ukraine bringen die
Regierungen Polens, der Slowakei, Ungarns, Bulgariens und Rumäniens
nicht nur die Frage nach mehr finanzieller Unterstützung aufs Tapet,
sondern stoßen auch eine dringend nötige Debatte an, die sich durch
den näher rückenden EU-Beitritt nur noch weiter verschärfen dürfte.
Dies führt uns zum dritten Punkt – dem agrarpolitischen Crashtest.
Durch die Konditionen, die die Europäische Union bereits im
vergangenen Frühjahr für die ukrainischen Exporte beschlossen hat,
wurden die ukrainischen Landwirte de facto bereits in den
Geltungsbereich des EU-Binnenmarktes einbezogen.
Europa wurde ohne jede Beschränkung mit ukrainischem Getreide
geflutet. Auf diese Weise haben wir damit praktisch eine Situation
geschaffen, die dem nahekommt, was geschehen wird, wenn die Ukraine
vollwertiges Mitglied der EU wird. Die entsprechende Reaktion anderer
Staaten in der Region erleben wir bereits. Jetzt ist der Zeitpunkt,
sich auf zukünftige Fälle solcher Art wirksam vorzubereiten.
Der vierte Punkt, der für die Ukraine auch eine Chance sein kann, ist
die Annäherung an Brüssel auf institutioneller Ebene. Wenn
mitteleuropäische Staaten durch den Erlass eigener Beschränkungen
verhindern, dass ukrainische Erzeugnisse auf den EU-Binnenmarkt
gelangen, verstoßen sie gegen die außen- und handelspolitischen Normen
der Union, denn einseitige Maßnahmen sind für dieses vereinheitlichte
System inakzeptabel.
Alles in allem ist offensichtlich, dass es bei den Importverboten für
ukrainisches Getreide nicht so sehr darum geht, die Landwirte zu
schützen, sondern darum, vor den anstehenden Wahlen mehr Subventionen
aus Brüssel zu bekommen. Die Führung der EU zeigt sich
kompromissbereit – der von Brüssel beschlossene Krisenfonds zur
Unterstützung der betroffenen Landwirte ist für die Länder
Mitteleuropas ein beruhigendes Zeichen. Die politischen Interessen
haben jedoch gegenüber internationalen sicherheits- und
wirtschaftspolitischen Erwägungen die Oberhand gewonnen.
Für die ukrainische Wirtschaft und Außenpolitik sind die Entwicklungen
rund um die Getreideausfuhren ein Signal – und zugleich ein Stresstest
für den Umgang mit Krisen, die sich im Rahmen einer engeren
Zusammenarbeit mit der EU einstellen. Ähnliche Beschränkungen und
Gegensätze werden unweigerlich auch im Zuge der Verhandlungen über den
EU-Beitritt der Ukraine auftreten. Die ukrainische Regierung und ihre
Diplomatinnen und Diplomaten tun gut daran, sich schon jetzt darauf
vorzubereiten.
Die Regierung der Ukraine muss lernen, dass sie verstärkt an ihrer
außenwirtschaftlichen Ausrichtung arbeiten muss. Momentan haben die
Sicherheits- und Außenpolitik für das Land natürlich Priorität, aber
die Ukraine sollte im Blick haben, dass die Verbündeten zuallererst
ihre eigenen Interessen verteidigen werden – besonders im sensiblen
Agrarsektor.
Wenn die Ukraine ihre Märkte sichern und weiterhin normale Beziehungen
mit ihren Partnern pflegen will, gibt es für sie nur eine Möglichkeit:
Kompromisse und gegenseitige Zugeständnisse. Nur so kann das Chaos zum
Ausgangspunkt für eine neue Ordnung werden.
——
8. Dr. Thomas Roithner: Zweite Chance für echte Friedens-EU
http://www.thomasroithner.at/cms/images/EU_Frieden_Nobelpreis_Furche_Thomas_Roithner.pdf
7.12.2022
Um zehn Jahre nach der Verleihung dem Friedensnobelpreis
tatsächlich gerecht zu werden, muss die EU ihr Friedensprojekt
nach innen wie außen fertig ausbauen.
Eine fiktive Nobelpreisrede
Zweite Chance für echte Friedens-EU
(…)
Der Autor ist Friedensforscher, Mitarbeiter im Internationalen
Versöhnungsbund
und Privatdozent für Politikwissenschaft an der Universität Wien
——
9. ZDK: ZURÜCK AN DEN VERHANDLUNGSTISCH“: ZDK-VOLLVERSAMMLUNG
DISKUTIERT VISIONEN FÜR DIE UKRAINE
Pressebericht des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
5.5.2023
https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/detail/-Zurueck-an-den-Verhandlungstisch-ZdK-Vollversammlung-diskutiert-Visionen-fuer-die-Ukraine-1558V/
Freitag, 5. Mai 2023
„ZURÜCK AN DEN VERHANDLUNGSTISCH“: ZDK-VOLLVERSAMMLUNG DISKUTIERT
VISIONEN FÜR DIE UKRAINE
"Zwischen Krieg und Frieden: Ethik, Strategien und Visionen für die
Ukraine": Unter diesem Titel diskutierte die Vollversammlung des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) heute mit Expert*innen
mögliche Wege zur Friedensfindung.
Zwischen Plädoyers für weitere militärische Unterstützung und dem
Wunsch nach einem schnellen Ende des Krieges stand die Frage im Raum:
Wie ist eine Rückkehr an den Verhandlungstisch denkbar?
Auf dem Podium tauschten Prof. Dr. Carlo Masala, Leiter der Professur
für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in
München, Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent beim Internationalen
Versöhnungsbund, Dr. Andriy Mykhaleyko, Privatdozent am Lehrstuhl für
Mittlere und Neue Kirchengeschichte an der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt und Jamila Schäfer MDB, Bündnis 90/Die Grünen,
Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und des Unterausschusses Vereinte
Nationen, internationale Organisationen und zivile Krisenprävention,
ihre Positionen aus. Moderiert wurde das Podium von Torsten Teichmann
(Bayerischer Rundfunk).
(…)
Um diesen Frieden realisieren zu können, braucht es nach Clemens
Ronnefeldt „eine breite internationale Unterstützung für einen
Waffenstillstand, ein Ende des Blutvergießens und der Zerstörungen in
der Ukraine, einen Rückzug der russischen Invasionstruppen sowie
umfangreiche humanitäre Hilfe für die notleidende ukrainische
Bevölkerung.“
Das Telefonat, das Xi Jingping jüngst mit dem ukrainischen Präsidenten
Selenskyi geführt habe, gebe erstmals Hoffnung, dass verhärtete Muster
aufbrechen könnten. Daran müsse weiter gearbeitet werden, so
Ronnefeldt. (…)
———
_3-Minuten-Eingangsstatement bei der ZdK-Vollverstammlung am 5.5.2023 in
München_
_bei der o.g. Podiumsdiskussion von Clemens Ronnefeldt zur Frage: _
_Wie kommen wir zu Frieden?_
In der vergangenen Woche haben der ukrainische Präsident Wolodymyr
Selenskyj und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erstmals seit
dem völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf die Ukraine eine
Stunde lang telefoniert.
Dabei hat Präsident Xi dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj
versichert, „dass China den Respekt der Souveränität und
territorialen
Integrität der Ukraine als Grundlage für die politischen Beziehungen
zwischen beiden Ländern betrachte“ - und dass die chinesische
Führung
sich für Verhandlungen einsetzen wolle.
Xi kündigte die Entsendung eines Sondergesandten für eurasische
Angelegenheiten in die Ukraine an, der "mit allen am Frieden
interessierten Parteien" Gespräche führen soll.
Außerdem wolle China der Ukraine "im Rahmen seiner Möglichkeiten"
humanitäre Hilfe leisten.
Präsident Selenskyj schrieb auf Twitter von einem "langen und
bedeutsamen" Gespräch mit dem chinesischen Staatschef, das den
bilateralen Beziehungen beider Länder hoffentlich einen "starken
Impuls" geben werde.
Kurz nach dem Telefonat gab Präsident Selenskyj die Ernennung eines
neuen Botschafters in China bekannt.
Die Bundesregierung wertete es als ein "gutes Signal", dass es jetzt
"einen Dialog auf höchster Ebene" zwischen China und der Ukraine gebe.
Ein Sprecher der EU-Kommission sah in dem Gespräch einen "wichtigen,
lang überfälligen Schritt". Chinas Führung müsse "ihren Einfluss
nutzen, um Russland zur Beendigung des Angriffskriegs zu bringen." (1)
Papst Franziskus sagte bei seinem Besuch letzten Sonntag in Ungarn:
„Ich denke, zu Frieden gelangt man, indem man Kanäle aufmacht.
Frieden
bekommt man nie, wenn man sich verschließt.“
Papst Franziskus sagte auf dem Rückflug auch: "Derzeit läuft eine
Mission, die aber noch nicht öffentlich ist".
Der Vatikan habe bereits bei Gefangenaustauschen als Vermittler agiert
und könnte dies nun auch tun im Zusammenhang mit der Rückführung
ukrainischer Kinder, die nach Russland verschleppt wurden. (2)
Eine hochrangige UN-Studiengruppe hatte sich im Vatikan am 6. und 7.
Juni 2022 in einer Abschlusserklärung zum Ukraine-Krieg mit dem Titel
„Eckpunkte für einen Waffenstillstand und ein positives
Friedensabkommen“ hinter die diplomatische Initiative des
italienischen Außenministeriums vom Mai 2022 gestellt.
Zum Jahrestag des russischen Überfalls am 24.2.2023 hat China einen
12-Punkte-Plan vorgelegt.
Mit Unterstützung von Ländern wie Indien, Brasilien, Mexiko und
Südafrika könnte auf der Basis des italienischen Friedensplanes sowie
des chinesischen 12-Punkte-Planes ein Waffenstillstand und ein Ende
des Blutvergießens erreicht werden.
Das Zentralkomitee des ZdK und der ZdK-Arbeitskreis „Nachhaltige
Entwicklung und globale Verantwortung“ haben am 20.9.2022 in Berlin
eine Erklärung zu „Friedensethik in Kriegszeiten“ verabschiedet:
Darin
heißt es:
„Wir fordern den Episkopat auf, sich im Vatikan für ein verstärktes
diplomatisches Engagement des Papstes einzusetzen“.
Diese Aufforderung könnte die ZdK-Vollversammlung in einer neuen
Erklärung noch einmal verstärken – und sich hinter die derzeitigen
Bemühungen des Papstes stellen.
(1)
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/selenskyi-xi-telefonat-100.html
(2)
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/papst-franziskus-frieden-ukraine-krieg-russland-100.html
———————————
10. MAY-MAY MEIJER UND KLAUS MOEGLING: FORDERUNG NACH MEHR UND NEUER
DIPLOMATIE: FÜR EINEN WAFFENSTILLSTAND UND DEN FRIEDEN IN DER UKRAINE
https://www.klaus-moegling.de/actual-blogs/
(…)
FORDERUNG NACH MEHR UND NEUER DIPLOMATIE: FÜR EINEN WAFFENSTILLSTAND
UND DEN FRIEDEN IN DER UKRAINE
von May-May Meijer und Klaus Moegling
8. Mai 2023
Der folgende Blog wurde insbesondere von May-May Meijer (Leiterin der
Friedens-NGO Peace SOS, The Netherlands) verfasst und auf ihren Wunsch
hin von Klaus Moegling um einige Perspektiven ergänzt.
Der Beitrag wird gemeinsam in englischer, deutscher und holländischer
Sprache
hier veröffentlicht. Er wird zeitgleich auf der internationalen
Webseite
von Peace SOS publiziert:
https://peacesos.nl/a-call-for-more-and-new-diplomacy-for-a-ceasefire-and-peace-in-ukraine/
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.
















 ICAN ist die 2017 ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnete “Internationale Campagnefür ein Atomwaffenverbot”. ICAN war aktiv daran beteiligt, dass die Vereinten Nationen den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht haben, der inzwischen in Kraft und von 68 Staaten unterschrieben ist. Deutschland gehört nicht zur den Unterzeichner-Staaten, dabei sind in der Bundesrepublik US-Atomwaffen im Rahmen der NATO stationiert. Diese Atomwaffen werden im Krisenfall von deutschen Piloten in die Angriffsziele gebracht. Der Umweltverband BUND ist seit dem März 2023 offizieller Partner von ICAN und unterstützt damit die Ziele für ein Atomwaffenverbot und fordert, dass die Bundesrebublik den Vertrag unterzeichnen soll.
ICAN ist die 2017 ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnete “Internationale Campagnefür ein Atomwaffenverbot”. ICAN war aktiv daran beteiligt, dass die Vereinten Nationen den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht haben, der inzwischen in Kraft und von 68 Staaten unterschrieben ist. Deutschland gehört nicht zur den Unterzeichner-Staaten, dabei sind in der Bundesrepublik US-Atomwaffen im Rahmen der NATO stationiert. Diese Atomwaffen werden im Krisenfall von deutschen Piloten in die Angriffsziele gebracht. Der Umweltverband BUND ist seit dem März 2023 offizieller Partner von ICAN und unterstützt damit die Ziele für ein Atomwaffenverbot und fordert, dass die Bundesrebublik den Vertrag unterzeichnen soll.