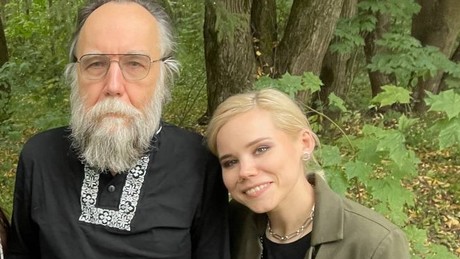BSW: Kein Erwachen aus dem Albtraum
Bündnis Sahra Wagenknecht
Pressekonferenz am 23.10. 2023
<https://rumble.com/embed/v3oiylj/?pub=105gth>
Dokumentiert: „Warum wir DIE LINKE verlassen“
Austrittserklärung von Sahra Wagenknecht und neun weiteren
Bundestagsabgeordneten <https://www.nachdenkseiten.de/?p=105706>
Bündnis Sahra Wagenknecht
Gründungsmanifest <https://buendnis-sahra-wagenknecht.de/bsw/>
https://freedert.online/meinung/184724-buendnis-sahra-wagenknecht-kein-erwachen/
23.10.2023
*Bündnis Sahra Wagenknecht:
Kein Erwachen aus dem Albtraum
*/Von Dagmar Henn
/Es dürfte weniger Hoffnung als Verzweiflung sein, die hinter den hohen
Umfragewerten für die noch nicht einmal gegründete Wagenknecht-Partei
steckt. Die Pressekonferenz, auf der das Projekt nun vorgestellt wurde,
hat nun belegt, dass auch nicht viel Hoffnung im Spiel ist.
Wer darauf gehofft hatte, die Pressekonferenz
<https://www.youtube.com/watch?v=avR8qxj1Fvs> des Vereins "Bündnis Sahra
Wagenknecht" wäre der Anfang eines Erwachens aus dem Albtraum, in den
sich die deutsche Politik verwandelt hat, wurde heute enttäuscht. Im
Gegenteil, es wurde klar, dass auch hier nicht viel erwartet werden kann
und dass die grundsätzlich falschen Motive im Vordergrund stehen.
Eine Übertreibung? Betrachten wir ein paar Beispiele. Das Erste: Was ist
der Grund für den Plan, eine neue Partei zu gründen? Die Antwort, die
Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter auf dieser Pressekonferenz gaben,
bestand aus zwei Punkten ‒ "eine Lücke im deutschen Parteiensystem
schließen" und:
/"Wären heute Bundestagswahlen, wäre die Linke ziemlich sicher nicht
mehr im Bundestag vertreten und die Rechten würden mit über 20 Prozent
dort einziehen. Das können und wollen wir so nicht akzeptieren, und wir
möchten uns der Verantwortung stellen, uns dieser Entwicklung
entgegenzustemmen."/
Es ist nicht der Zustand des Landes, auch nicht die Wiederherstellung
der Souveränität oder die Tatsache, dass die herrschende Politik gegen
die Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist, sondern das fehlende
"politische Angebot" und der Aufstieg der AfD, die als Grund benannt
werden, jetzt einen Schritt zu tun, dessen politische Notwendigkeit
bereits seit Jahren auf dem Tisch liegt.
Und die Orientierung geht nicht auf eine Partei als Organisation von
Menschen, die gemeinsam einen politischen Willen umsetzen wollen,
sondern auf einen Wahlverein. Ähnlich wie in den Anfangstagen der WASG,
einer der beiden Ursprungsorganisationen der Linken, ist zu merken, dass
alle Fragen von Selbstermächtigung, von politischer Beteiligung der
Bürger weit unter "ferner liefen" kommen. Was angesichts der realen Lage
im Land ein schwerer Fehler ist, denn wenn der Karren so tief im Dreck
steckt (und er steckt weit tiefer darin, als alle bisherigen Aussagen
des Wagenknecht-Vereins erkennen lassen), dann braucht es eine große
Anstrengung, ihn wieder herauszuziehen, bei der Abgeordnete, egal auf
welcher Ebene, egal in welcher Zahl, nur einen kleinen Teil darstellen
können.
Alle Vertreter auf dem Podium der Bundespressekonferenz bewegen sich
gleichermaßen vor allem in der abgeschotteten Welt der Berufspolitik.
Das merkt man auch daran, wie bereitwillig sie sich die Zukunft der
Fraktionsmitarbeiter als bedeutsames Thema aufs Auge drücken lassen.
Die versammelte Journaille verfolgt natürlich das Ziel, aus dem ganzen
Projekt Haare in Suppe zu machen, aber sich mehrmals auf die Frage nach
der Zukunft von, wie Dietmar Bartsch jüngst erklärte
108 Fraktionsmitarbeitern einzulassen, statt schlicht kategorisch zu
erklären, für die Gründung einer Partei sei die Zukunft eines Landes von
80 Millionen Einwohnern entscheidend und nicht die persönliche Karriere
von 108 Fraktionsmitarbeitern, das ist peinlich.
Ja, es sind die Menschen, mit denen man in Berlin täglich umgeht. Aber
man muss sich, wenn man einen sozialen Anspruch hat, auch darüber im
Klaren sein, dass sie nicht wichtiger sind als beispielsweise die
Mitarbeiter der chemischen Industrie, die ebenfalls gerade ihre
Perspektive verlieren und die weit mehr als 108 Köpfe zählen.
In der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie hat diese Sicht ein
unangenehmes Vorbild. Ein damaliger linker Sozialdemokrat, Julian
Borchardt, beschrieb
<https://www.marxists.org/deutsch/archiv/borchardt/1915/august1914/abgedankt.htm>
die Argumente, die die Mehrheit der Reichstagsfraktion 1914 dazu
brachten, für die Kriegskredite zu stimmen, und die danach einen
völligen Umschwung in den etwa 600 Zeitungen der Partei in Deutschland
auslösten. Es war die Furcht vor den dann möglichen Repressionen.
/"Am 28. September, in einer Konferenz der sozialdemokratischen
Redakteure, setzte der Kassierer des Parteivorstandes, Otto Braun,
auseinander, dass in den geschäftlichen Unternehmungen der Partei 20
Millionen Mark Kapital stecken und ca. 11.000 Angestellte beschäftigt
werden. […] So entschloss man sich, die Erlaubnis zum Wiedererscheinen
des "Vorwärts" mit der bekannten Versicherung zu erkaufen, dass er
während des Krieges das Thema Klassenkampf nicht behandeln werde."/
Nun, die Zahlen sind mittlerweile geschrumpft, aber selbst 108
Mitarbeiter einer Fraktion erhalten noch mehr Gewicht als das restliche
Land. Von beiden Seiten in dieser Pressekonferenz. Das ist leider
symptomatisch.
Genauso, wie die Argumentation schwach bleibt, als, ebenfalls mehrfach,
die Frage erfolgt, warum sie denn nicht alle ihre Mandate abgäben, um
durch ein Nachrücken von den Landeslisten im Interesse besagter 108
Fraktionsmitarbeiter den Fraktionsstatus der Linken zu erhalten.
Eigentlich eine völlig absurde Fragestellung, da das Mandat nach der
Verfassung durch die Wähler vergeben wird ‒ nicht die Parteien sind der
Souverän. Doch für beide Seiten spielt die Bevölkerung keine große
Rolle, eine Verpflichtung dieser gegenüber schon gar nicht.
Ja, es gibt auch zutreffende Aussagen. "Selbst als die Wirtschaft in
Deutschland noch brummte, sind viele Menschen mit ihrem Einkommen kaum
über den Monat gekommen", sagt Wagenknecht beispielsweise. Weder sie
noch das Gründungsmanifest <https://www.nachdenkseiten.de/?p=105712>
erwähnt aber explizit, dass dies die Folge zielgerichteter Politik ist.
Da war die Linke zum Zeitpunkt ihrer Gründung noch deutlicher.
Es gibt Nachfragen zum Thema EU; schließlich wird angekündigt, die neue
Partei, die im kommenden Januar gegründet werden soll, werde zur
nächsten Europawahl antreten. Auch hier: Eine grundsätzliche Kritik an
der EU findet nicht statt.
/"Wir sind nicht der Meinung, dass immer mehr Befugnisse an die
EU-Kommission verlagert werden sollen. Wir wünschen uns, dass im
Interesse der Demokratie auch wieder mehr in den einzelnen Ländern
entschieden wird./
Sich dagegen auszusprechen, noch weitere Befugnisse an die EU-Kommission
zu verlagern, ist etwas anderes, als zu sagen, dass die EU-Kommission
bereits viel zu viele Befugnisse hat. Man denke nur an den Deal von
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Pfizer. Oder die Art
und Weise, wie die EU-Kommission die Außenpolitik an sich reißt.
Die Antwort, die Wagenknecht gibt, ist vorsichtig, zahm. Das ist das
nächste Problem – die neue Partei scheint sich bereits vor ihrer
Gründung in die gleiche Gefangenschaft begeben zu haben, die so viel zum
Untergang der Linken beitrug, das Schielen auf mögliche Koalitionen, das
sich unverkennbar auch auf die Grünen richtet, mithin die
kriegslüsternste, US-gläubigste Partei, die in Deutschland zu finden
ist. Der deutlichste Beleg findet sich in einer Aussage Wagenknechts:
/"Ich finde es gut, wenn Menschen, die die Ampel gewählt haben und die
jetzt zutiefst enttäuscht sind, wenn sie jetzt auf unser Projekt
Hoffnung setzen."/
Und im Gegensatz dazu die einzige Stelle, an der sie eine feste Position
einnimmt:
/"Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sache mit der AfD machen."/
Die Angst vor den Vorwürfen, die in der Presse erhoben werden könnten,
ist stärker als der politische Wille. Denn es wäre durchaus möglich, zu
sagen: "Wir sehen, dass es in der AfD starke neoliberale Kräfte gibt,
aber wir entscheiden es an den konkreten Fragen, mit wem wir
zusammenarbeiten." Man kann sagen, die AfD vertrete nicht die Interessen
der arbeitenden Bevölkerung; aber das unterscheidet sie mitnichten von
SPD, Grünen, CDU und FDP. Man kann sagen, dass man die AfD für zu
NATO-freundlich hält, aber dazu müsste man erst selbst eine klare
Position einnehmen.
Aber explizit, und gleich mehrfach, die angestrebte Gründung vor allem
als ein Projekt gegen die AfD zu definieren, das ist Selbstmord aus
Angst vor dem Tod. Was immer man der AfD vorwerfen will oder kann, für
den augenblicklichen Zustand der deutschen Politik ist sie nicht
verantwortlich, und man muss zumindest zugestehen, dass sie in Bezug auf
die Beziehungen mit Russland kein gar so jämmerliches Bild abgab wie die
Linke und nach dem Anschlag auf Nord Stream das Thema der deutschen
Souveränität wenigstens ins Gespräch gebracht hat.
Die Antworten, die Sahra Wagenknecht auf die Fragen nach der EU gegeben
hat, zeigen ebenso wie die Formulierung im Gründungsmanifest, dass die
Schärfe, in der sich diese Frage stellt, nur ansatzweise erkannt ist.
Das Gründungsmanifest:
/"Unser Land verdient eine selbstbewusste Politik, die das Wohlergehen
seiner Bürger in den Mittelpunkt stellt und von der Einsicht getragen
ist, dass US-amerikanische Interessen sich von unseren Interessen
teilweise erheblich unterscheiden."/
Unterscheiden? Es dürfte doch wohl seit Nord Stream klar sein, dass die
Interessen der deutschen Bevölkerung und jene der US-Regierung
miteinander unvereinbar sind. Wenn auf der wirtschaftlichen Ebene die
deutschen Milliardäre ein ebenso großes Interesse an der Erhaltung der
US-Hegemonie haben wie die US-amerikanischen (aber nicht die
Bevölkerung), ändert das nichts an der Tatsache, dass die völlige
Unterordnung unter die US-Politik, die gegenwärtig betrieben wird, für
die Interessen Deutschlands absolut selbstzerstörerisch ist.
Um aber aus dem augenblicklichen politischen Elend überhaupt wieder zu
einer Formulierung dieser Interessen zu kommen, wäre es nötig, die
ganze, reichhaltige Astroturf-Landschaft, das Gestrüpp aus Stiftungen
und "Nichtregierungsorganisationen
nicht, nur "demokratische Willensbildung wiederbeleben" zu wollen. Wenn
es einen Beschluss bräuchte, irgendeiner Seite gegenüber von Anbeginn an
die Zusammenarbeit zu verweigern, dann wären es derzeit alle
US-finanzierten Strukturen. Und natürlich alles, was irgendwie mit dem
grünen Parteigeheimdienst zu tun hat. Und hier reden wir von den
Voraussetzungen einer Rückgewinnung von Demokratie und noch lange nicht
von einer Wiederbelebung demokratischer Willensbildung.
Es kann in manchen Momenten geradezu zu Tränen rühren, mit welchem Eifer
zu kurz gesprungen wird. Zwar benutzt Wagenknecht die Bezeichnung
"Freiluftgefängnis" für Gaza – eine Formulierung, die übrigens selbst
Amnesty International mal in Umlauf brachte ‒, aber als sie mehrfach
gefragt wird, wer denn der Gefängniswärter sei, weicht sie jedes Mal
aus, in lange Satzperioden, wie wichtig doch Verhandlungen seien
(übrigens, das Wort Ukraine fiel in der Pressekonferenz kein einziges
Mal, so geht es dem Thema von gestern).
Sie redet vom brutalen Angriff der Hamas, verliert aber kein Wort über
die brutale Bombardierung der palästinensischen Zivilbevölkerung, und
bezieht sich sogar positiv auf US-Präsident Joe Biden, der auch von der
Belastung der Zivilbevölkerung gesprochen habe. Als wäre Biden nicht
jener eine Mensch, der eine Waffenruhe und eine Aufhebung der
völkerrechtswidrigen Blockade durch einen einzigen Anruf erwirken
könnte. Sie sagt, dass "die Gefahr besteht, dass sehr, sehr viele
Menschen sterben und dass der ganze Nahe Osten ein Pulverfass werden
könnte." Nachricht aus der Wirklichkeit: Das ist bereits geschehen, das
Pulverfass steht mit offenem Deckel da, und es ist die israelische
Regierung, die derzeit mit dem Streichholz in der Hand davor steht.
"Den Pudding müssen wir jetzt doch noch an die Wand kriegen", wurde die
dritte Nachfrage zum Thema Freiluftgefängnis eingeleitet.
Der Meinungskorridor in Deutschland müsse wieder breiter werden, sagte
Wagenknecht relativ zu Beginn, die Hälfte der Bevölkerung traue sich
nicht mehr, außerhalb geschützter Räume die eigene Meinung überhaupt
noch zu äußern. Das ist allerdings nicht nur die Folge von Diffamierung
und Stigmatisierung, sondern auch von unzähligen Strafverfahren. Der
Raum einer rein ideellen Verweigerung von Meinungsfreiheit wurde längst
verlassen, inzwischen steht vielfach die Äußerung der Wahrheit unter
Strafe, und Wagenknecht selbst ist ein lebendes Beispiel dafür, zu
welchen Verzerrungen der dauerhafte Druck und die Angst vor den
Angriffen führt.
Denn es gibt, etwa ab Minute 14 der Pressekonferenz, eine überaus
peinliche Passage. Peinlich weniger, weil sie Wagenknechts Schwäche
zeigt, sondern vor allem, weil diese Schwäche tatsächlich die
Möglichkeiten, die Entwicklung in Deutschland umzukehren, einschränkt.
Es ist eine Sache, nicht zu verstehen oder nicht zu sagen, wie sich die
globalen Verhältnisse gerade ändern, und die Aufgabe nicht zu sehen, für
Deutschland einen Weg in eine Welt der globalen Gleichheit zu finden. Es
ist eine andere, sich dem aktiv zu verweigern, indem man selbst die
üblichen Verleumdungen aufgreift.
Sie kritisiert, dass man ihr Nähe zu Putin unterstelle. Dann bittet sie
die versammelte Presse, sie nicht "in die Nähe von zwielichtigen
Personen zu bringen, mit denen wir nichts zu tun haben". Der
darauffolgende Satz beginnt mit "neben der unterstellten Putinnähe".
Das mag keine bewusste Aussage gewesen sein, so raffiniert ist sie
nicht. Aber die Abfolge der Sätze verknüpft den Begriff "zwielichtige
Person" mit dem russischen Präsidenten, und nur mit dem russischen
Präsidenten (während sie sich auf den US-Präsidenten Joe Biden, ein
Paradebeispiel politischer Korruption, positiv bezieht, von der Leyen
als Mutter der EU-Korruption nicht benennt und den chinesischen
Präsidenten nicht einmal wahrzunehmen scheint).
Das ist ein mindestens ebenso tiefer Kotau vor dem Gespinst des
Mainstreams wie ihr mehrfach belegter Gebrauch der Floskel vom
"russischen Angriffskrieg". Sie sollte die Frisur ändern. Auf der Skala
von 1914 schafft sie es höchstens bis Hugo Haase, aber keinesfalls bis
Rosa Luxemburg.
Das wäre kein großes Problem, stünde hinter ihr eine lebendige Partei,
die diesen persönlichen Mangel an Mut ausgleichen könnte. Aber der
Verein hat erklärt, er wolle strenge Kontrolle über die Mitgliedschaft
der künftigen Partei ausüben, wobei nicht die mögliche Unterwanderung
durch transatlantische Netzwerke als Problem benannt wird, sondern die
Befürchtung, dass es zu "Chaos und Streitigkeiten" kommen könnte.
Abgesehen davon, dass das deutsche Parteienrecht eine solche Kontrolle
nur begrenzt zulässt und die versammelten Vorstandsmitglieder des
Vereins kaum den Eindruck erwecken, auf eine Kandidatenzeit
zurückgreifen zu wollen, stellen sich in diesem Zusammenhang zwei
Fragen: Wer sind die Personen, die darüber entscheiden, wer genehm ist
und wer nicht, und wer sind die Personen, die diese Struktur jetzt tragen?
Es war zu einem guten Teil die Zurichtung auf eine Koalitionsfähigkeit
mit SPD und Grünen, die die Linke in den heutigen Zustand gebracht hat.
Dieselben Gründe führen schon vor der Gründung zu wachsweichen
Formulierungen in Bezug auf die NATO, die EU, die gegen die Bevölkerung
gerichtete Klimapolitik und die Frage der nationalen Souveränität.
Das ist traurig. So vieles müsste in der deutschen Politik gesagt und
diskutiert werden, wird es aber nicht. Wenn die neue Partei dem
entspricht, was heute auf der Pressekonferenz präsentiert wurde, wird
sie kein Ansatz zur Veränderung, sondern nur ein weiteres
Trostpflästerchen, ein Quell für vorsichtige Einwände, die nichts am
realen Niedergang ändern. Das Land hat Besseres verdient.