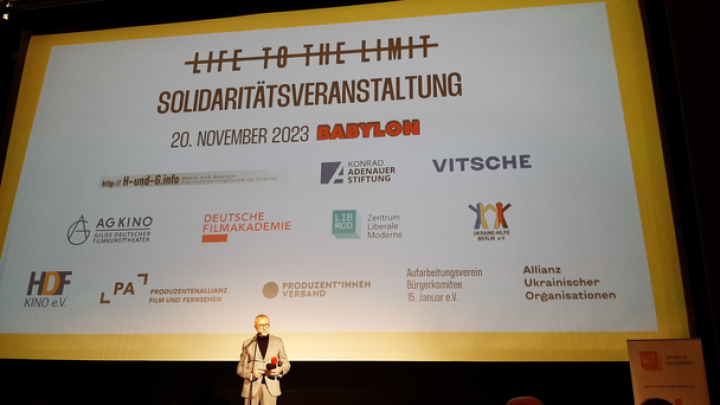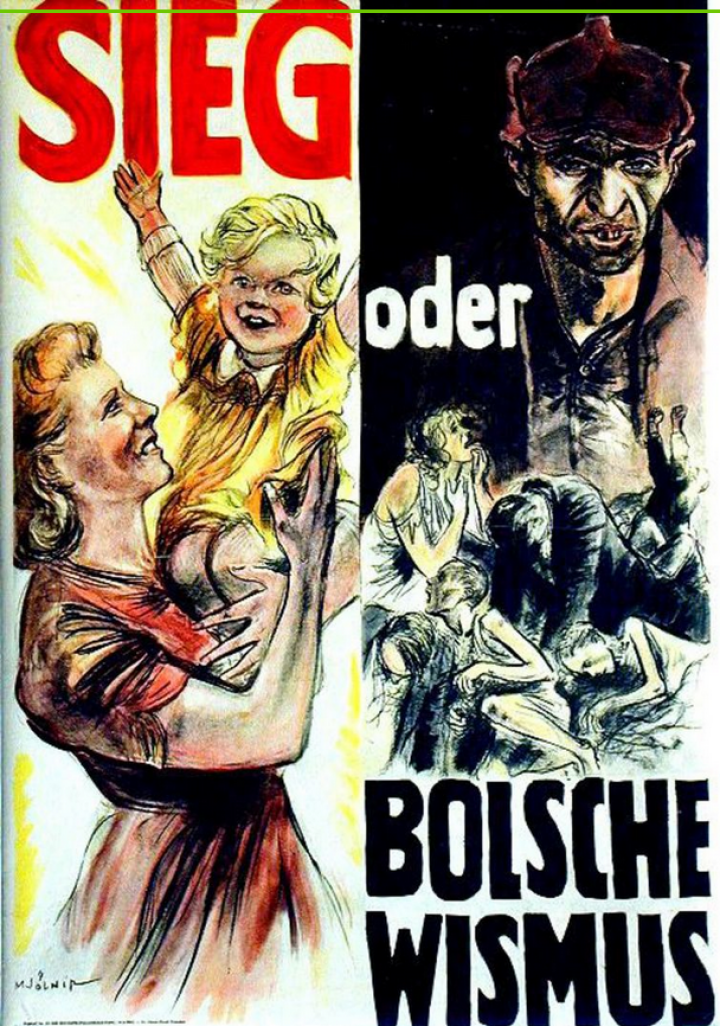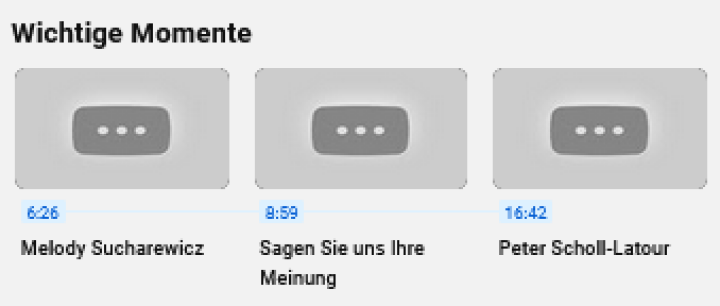aus e-mail von Doris Pumphrey, 3. November 2023, 16:21 Uhr
Joschka Fischer:
"*Ich schäme mich für unser Land*"
Der frühere Außenminister spricht über Krieg in Nahost, deutsche
Verantwortung und die Krise der Grünen. Und rüttelt am Tabu seiner
Partei: Er fordert neue Atomwaffen.
Interview: Fabian Reinbold und Georg Löwisch • Fotografie: Jacobia Dahm
3. Dezember 2023, 9:02 Uhr/
/
/"Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz" – das war eine Maxime, an der
Joschka Fischer seine Politik in der Zeit als erster grüner
Außenminister (1998–2005) ausgerichtet hat. Was bedeutet der Satz heute,
wo Israel gegen Terror in den Krieg zieht, die Ukraine nur noch schwer
dem russischen Überfall standhält und die Deutschen sich gedanklich
zurückziehen? Der 75-Jährige empfängt in seinem Büro am Berliner
Gendarmenmarkt./
ZEIT ONLINE: Herr Fischer, was haben Sie seit dem 7. Oktober, dem
terroristischen Überfall der Hamas auf Israel, über Deutschland gelernt?
Joschka Fischer: Was seitdem in Deutschland passiert ist, hätte ich
nicht für möglich gehalten. Jüdische Eltern müssen Angst haben, ihre
Kinder in die Schule zu schicken. Wohnungen von Juden werden mit
Davidsternen beschmiert. Antiisraelische und antijüdische Parolen stehen
an Häuserwänden. Ich schäme mich für unser Land.
ZEIT ONLINE: Vor dem Auswärtigen Amt gab es eine Protestkundgebung mit
dem Slogan: "Free Palestine from German guilt." Was denken Sie darüber?
Fischer: Der Frieden in dieser Region ist nicht durch ein "Free
Palestine!" zu erreichen. Wahr ist aber auch: Es wird keinen Frieden
geben, wenn man meint, die Palästinenser bei den Bemühungen darum
vergessen zu können. Das ist eine der großen Illusionen, die am 7.
Oktober zerplatzt sind. In der israelischen Regierung und in weiten
Teilen der israelischen Öffentlichkeit hat man geglaubt, man könne
Frieden mit den arabischen Staaten schließen und die Palästinenser
ignorieren. Ein Irrtum. Nur wenn Israelis und Palästinenser einen Weg
zueinanderfinden, wird dies Sicherheit und Freiheit für alle Beteiligten
bringen. Aber das wird immer schwieriger, immer unwahrscheinlicher. Leider.
ZEIT ONLINE: Aber die Demonstrierenden vor dem Auswärtigen Amt gingen ja
noch weiter: Palästina solle von deutscher Schuld befreit werden,
forderten sie. Was wohl meint, dass die Palästinenser nicht ausbaden
sollen, was die Deutschen mit dem Holocaust angerichtet haben.
Fischer: Was für ein gefährlicher Quatsch! Palästina kann nicht von
deutscher Schuld befreit werden. Die deutsche Schuld ist allein unsere
Angelegenheit. Unsere Geschichte wiegt schwer. Wir dürfen keinen Zweifel
daran aufkommen lassen, dass wir den Staat Israel unterstützen.
ZEIT ONLINE: Als junger Mann in den Sechzigerjahren waren Sie selbst in
einer Protestbewegung unterwegs, die Ungerechtigkeit gegenüber den
Palästinensern anprangerte. Später sprachen Sie von einem inneren
Dilemma. Erkennen Sie den Fischer von damals in den Demonstrationen?
Fischer: Nein. Nachdem es im Sechstagekrieg im Jahr 1967 zur totalen
Niederlage der arabischen Armeen gegen Israel kam, hatte ich tatsächlich
großes Mitgefühl mit dem Schicksal der Palästinenser und empfand, dass
dieses Volk von Israel unterdrückt wurde. Aber das bedeutete zu keinem
Zeitpunkt, dass ich Israels Existenzrecht infrage gestellt hätte. Die
deutsche Schuld an der Sh h hat meine politische Identität früh
geprägt. Als Außenministe r habe ich dann erlebt, wie unglaublich schwer
es ist, die israelische Position gerade jungen Menschen zu erklären.
Wenn man sieht, wie Menschen im Westjordanland Steine werfen auf
israelische Soldaten, die ihrerseits mit modernsten Waffen ausgestattet
sind, hat man den Eindruck, das sei unfair. Aber Israel kann sich
Schwäche nicht erlauben. Sonst wird es nicht mehr existieren.
ZEIT ONLINE: Sie haben sich in der Nahostdiplomatie engagiert, waren als
Außenminister 15-mal in Israel und in den Palästinensischen Gebieten.
Hat Israel entschlossen genug nach der Zweistaatenlösung gesucht?
Fischer: In den späten Neunzigerjahren ja, da wäre Frieden möglich
gewesen. Das war nach den Verhandlungen von Oslo, Israels Premier Izchak
Rabin und Palästinenserchef Jassir Arafat lebten noch, und diese beiden
waren entscheidend. Nach dem Mord an Rabin 1995 begann dann der
Niedergang. Den habe ich direkt miterlebt. Seitdem gab es nicht mal mehr
die Vision eines friedlichen Ausgleichs zwischen diesen beiden Völkern,
die um dasselbe Land kämpfen. Arafat hat zudem den großen Fehler
begangen zu glauben, er könne Israel in die Knie zwingen mit der
bewaffneten Intifada. Und das hat wiederum zu einem Rechtsruck der
Politik in Israel geführt. Unter Benjamin Netanjahu glaubte Israels
Regierung dann, wie schon gesagt, man könne die Palästinenser vergessen.
Das war ein großer Fehler.
ZEIT ONLINE: Zwischendurch regierte Ariel Scharon, unter dem Israel 2005
aus dem Gazastreifen abzog.
Fischer: Scharon war das, was man einen harten Hund nennt. Aber wir
schätzten uns. Wir haben viele Stunden unter vier Augen gesprochen. Als
er einseitig aus Gaza abzog, habe ich das für einen Fehler gehalten und
habe ihm das auch gesagt. Da wurde er wütend.
ZEIT ONLINE: Was kritisierten Sie?
Fischer: Dass Israel einfach ging, ohne eine Lösung verhandelt zu haben.
Scharon war der Meinung, mit dem Abzug wäre das nicht mehr Israels
Angelegenheit. Ich fand, dass das ihre Angelegenheit bleibt, ob sie
wollten oder nicht. Und dann kam es eben zum Triumph der Hamas. Sie
gewann die Wahlen und fegte die Fatah einfach weg. Und trotzdem muss ich
zugeben: Ich habe die Hamas unterschätzt.
ZEIT ONLINE: Sie meinen den Angriff vom 7. Oktober?
Fischer: Ja, ich hätte es einer Terrorgruppe wie der Hamas nie
zugetraut, einen solchen Plan zu entwickeln. Sie hat das Trauma der
Shoah reaktiviert, und zwar im vollen Tageslicht. Genau das war der Plan
– so wie die Hamas auch ganz bewusst die israelische Regierung in eine
Situation bringen wollte, in der sie hart zurückschlagen muss, weil
Israel es sich nicht erlauben kann, schwach zu sein. Auch dass die
Führungen der arabischen Staaten unter Druck geraten, ist kalkuliert.
All das war geplant, so perfekt wie perfide.
ZEIT ONLINE: Kann man die Hamas überhaupt besiegen?
Fischer: In diesem irdischen Jammertal ist alles, was Menschen schaffen,
besiegbar. Die Frage ist nur, in welchem Zeitraum. In ihrer
verzweifelten Situation sympathisieren viele Palästinenser mit den
Terroristen. Um sie da rauszuholen, wird es einer großen Anstrengung
bedürfen.
*"Der Iran ist das große Hindernis für den Frieden"*
ZEIT ONLINE: Wer könnte denn an die Stelle der Hamas treten?
Fischer: An einer Erneuerung der Fatah führt kein Weg vorbei. Es kann
weder auf Mahmud Abbas hinauslaufen noch auf andere Mitglieder der
jetzigen palästinensischen Führung. Da braucht es neue Personen und neue
Ideen, das wird nicht einfach.
ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielt der Iran?
Fischer: Der Iran ist das große Hindernis für den Frieden. Das Regime
ist innenpolitisch geschwächt, aber außenpolitisch nach wie vor stark
und in seinen Berechnungen sehr kalt. Der Iran hat in der ganzen Region
ein Netzwerk von Terrorgruppen aufgebaut, das er finanziert und mit
Waffen ausstattet. Die stärkste Stellung außerhalb des Iran ist im
Libanon die Hisbollah, die über 100.000 zielgenaue Raketen moderner Art
verfügt. Der Iran stärkt alle Kräfte, die Israel vernichten wollen.
ZEIT ONLINE: Ist das ein Mittel zum Zweck – oder ist Vernichtung Israels
das wahre Ziel des Iran?
Fischer: Die iranische Bevölkerung hat eigentlich keine großen
Vorurteile gegen ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Seit dem
Altertum leben dort Juden, selbst nach der Islamischen Revolution sind
Tausende geblieben, es gibt aktive Synagogen. Allein das gegenwärtige
Regime arbeitet an der Zerstörung Israels, und die wollen das wirklich.
Sie sehen darin einen strategischen Hebel, eine hegemoniale Rolle im
Nahen Osten zu spielen. Sie nutzen den Palästina-Konflikt sehr
geschickt, um Menschen in den arabischen Staaten für sich zu mobilisieren.
ZEIT ONLINE: "Nie wieder Auschwitz", das war Ihre außenpolitische
Maxime. Was bedeutet das heute?
Fischer: Dass wir in der Pflicht stehen, dass in unserem Land nie wieder
Minderheiten verfolgt und getötet werden dürfen. "Die Würde des Menschen
ist unantastbar", dieser erste Satz in unserem Grundgesetz ist der
Inbegriff dessen, was aus "Nie wieder Auschwitz" folgt. Wir haben eine
Schutzverpflichtung. Nicht nur gegenüber dem jüdischen Staat, sondern
auch gegenüber unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und
gegenüber Juden generell.
ZEIT ONLINE: War es richtig, dass sich Außenministerin Annalena Baerbock
Ende Oktober bei einer UN-Abstimmung zu einer Resolution enthalten hat,
die die Hamas nicht verurteilt und Israels Recht auf Selbstverteidigung
nicht erwähnt – während etwa die USA dagegen gestimmt haben?
Fischer: Deutschland muss immer, wenn es hart auf hart kommt, an der
Seite Israels stehen. Aber ich kann auch verstehen, was die Überlegungen
waren, dass man sich enthalten hat. Es gab keine einheitliche Position
der EU-Partner, und man wollte offensichtlich in dieser Frage die Drähte
in die arabische Welt offenhalten. Ich kann nur darüber spekulieren,
aber das war wirklich keine leichte Frage. Ich habe an der Haltung von
Annalena nicht den geringsten Zweifel. Sie steht fest zu unserer
historischen Verpflichtung und zu den Menschen in Israel.
ZEIT ONLINE: Wenn wir schon bei Ihren Nachfolgern bei den Grünen sind.
Robert Habeck hat eine viel beachtete Rede gehalten: Eingestiegen ist er
mit dem Massaker in der Schlucht von Babyn Jar 1941 auf dem Gebiet der
heutigen Ukraine. Hat er mit dieser Rede definiert, was "Nie wieder
Auschwitz" heute bedeutet?
Fischer: Die Rede war großartig und dringend nötig. Es war nicht die
Rede eines Wirtschaftsministers oder eines Vizekanzlers. Es war die Rede
eines Bundeskanzlers. Mich hat der historische Tiefgang seiner Ansprache
genauso beeindruckt wie die deutliche Ermahnung, was es heißt, in
Deutschland zu leben oder hier leben zu wollen. Dass dies eine
Verpflichtung gegenüber Israel beinhaltet, die uns alle betrifft.
ZEIT ONLINE: Genau für diesen Aspekt ist Habeck aber auch kritisiert
worden. Er forderte von Muslimen in Deutschland ein Bekenntnis ein. Wer
Toleranz wolle, müsse sich erst einmal klar vom Antisemitismus
distanzieren. Haben Muslime hierzulande diese Bringschuld?
Fischer: Wir sind schon lange ein Einwanderungsland. Unser Land war
immer offen für Flüchtlinge, aber wir haben einen Fehler gemacht: Wir
haben nicht definiert, was es heißt, hier leben zu wollen. Offen zu sein
heißt eben nicht, dass wir für alles zu haben sind. Wir sind das Land,
das Auschwitz möglich gemacht hat. Das schwer an seiner Geschichte trägt
und das sich dieser Geschichte gestellt hat. Und das hat Konsequenzen
für alle Bürger und Bürgerinnen. Wer das nicht begreift, hat die falsche
Adresse gewählt. Und das gilt nicht nur für das Thema Antisemitismus.
ZEIT ONLINE: Worauf wollen Sie hinaus?
Fischer: Auch wer meint, Frauenunterdrückung gehöre zum Alltag, ist bei
uns falsch. In Deutschland ist der Anspruch auf Gleichberechtigung
längst nicht verwirklicht, aber wir müssen danach streben. Jungs und
Mädchen sind gleich. Dass wir unsere Werte, die Werte des Grundgesetzes,
nicht stärker durchsetzen, habe ich nie verstanden.
"*Die Ukraine ist für uns von entscheidender Bedeutung*"
ZEIT ONLINE: Wie blicken Sie auf die aktuelle Bundesregierung, die in
der Krise steckt?
Fischer: Ich habe mir geschworen: Was ich an Kritik habe, behalte ich
für mich oder diskutiere es mit Freundinnen und Freunden, aber nicht mit
Ihnen in den Medien.
ZEIT ONLINE: Sie fürchten, für einen der alten Knacker in der Muppet
Show gehalten zu werden, der von seinem Balkon herunter die Dinge
kommentiert?
Fischer: Genau, und das zu Recht! Im Ernst: Die Grünen machen das alles
sehr gut. Die Partei hat große Probleme, aber sie kennt ihre Probleme,
und da braucht es nicht noch einen Beitrag von mir zur Verstärkung der
Schwierigkeiten.
ZEIT ONLINE: Auf dem denkwürdigen Parteitag Ihrer Grünen in Bielefeld
1999, wo Sie mit einem Farbbeutel beworfen wurden, riefen Sie:
"Auschwitz ist unvergleichbar. Aber ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie
wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Nie wieder Völkermord, nie wieder
Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen." Was bedeutet dieser
Leitsatz heute für Deutschlands Außenpolitik, konkret für unsere Rolle
im Krieg Russlands gegen die Ukraine?
Fischer: Die Ukraine ist für Europa und Deutschland von entscheidender
Bedeutung. Die Putinsche Ideologie lautet: Die Macht entscheidet, nicht
das Recht. Wenn sich dieses Denken durchsetzt, dann können Sie Europa
vergessen. Insofern geht es um verflucht viel.
Wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen.
Joschka Fischer über den Umgang mit Russland
ZEIT ONLINE: Aber was folgt daraus nach bald zwei Jahren Krieg?
Fischer: Was daraus zuallererst folgt, ist, dass wir Europäer aufrüsten
müssen. Wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen. Nein,
mir gefällt dieser Gedanke überhaupt nicht und ich wüsste tausend andere
Dinge, die ich lieber finanzieren würde. Aber es führt kein Weg daran
vorbei. Solange wir einen Nachbarn Russland haben, der der imperialen
Ideologie Putins folgt, können wir nicht darauf verzichten, dieses
Russland abzuschrecken. Nur werden wir das nicht mit Schuldenbremse und
ausgeglichenen Haushalten erreichen können.
ZEIT ONLINE: Gehört zur Abschreckung auch, dass die Bundesrepublik sich
eigene Atomwaffen anschafft?
Fischer: Das ist in der Tat die schwierigste Frage. Sollte die
Bundesrepublik Atomwaffen besitzen? Nein. Europa? Ja. Die EU braucht
eine eigene atomare Abschreckung.
ZEIT ONLINE: Das fordern ausgerechnet Sie? Die Gründung der Grünen ist
eng verbunden mit dem Widerstand gegen atomare Aufrüstung Anfang der
1980er.
Fischer: Die Welt hat sich verändert, Putin arbeitet auch mit nuklearer
Erpressung. Ich hoffe, dass Amerika und Europa verbunden bleiben. Aber
was wird sein, wenn Donald Trump wiedergewählt wird? Auch mit Blick auf
dieses Szenario muss sich Europa die Frage ernsthaft stellen.
ZEIT ONLINE: Großbritannien und Frankreich verfügen über ein nukleares
Arsenal.
Fischer: Der Verweis darauf als Antwort auf die veränderte Lage wäre zu
einfach und zu kurz gedacht. Die Priorität hat aber erst mal die
Abschreckungsfähigkeit im konventionellen Bereich. Das ist die Lektion,
die uns die Ukraine lehrt. Die Ukraine braucht dringend eine effektive
Luftabwehr. Und wir als Europa brauchen dringend eine effektive
Luftverteidigung. Wir müssen das gemeinsam machen. Auch gegen
Cyberaggression müssen wir abschreckungsfähig und verteidigungsfähig
werden.
ZEIT ONLINE: Israel, der 7. Oktober, die Ukraine, die Krise der
Bundesregierung. Was gibt Ihnen überhaupt Hoffnung?
Fischer: Wir befinden uns in einer Dreifachkrise. Die geopolitische
Krise mit dem Rückzug Amerikas und dem Versuch aufsteigender oder alter
Großmächte, das Vakuum zu füllen. Die zweite ist die technologische
Krise. Nehmen Sie künstliche Intelligenz: Wir gehen durch eine Tür, von
der wir nur wissen, dass wir in einer anderen Realität ankommen werden,
die und deren Risiken wir aber nicht kennen. Und das Dritte ist die
verdrängte Großkrise des Klimas. Die ignorieren wir, nach dem Motto, das
wird schon gut gehen. Nein, es wird nicht gut. Und diese drei globalen
Großkrisen verschränken sich zu einer.
ZEIT ONLINE: Wir hatten nach Hoffnung gefragt.
Fischer: Der Homo sapiens gibt mir Hoffnung. Wir sind, wie wir sind. Im
Guten wie im Schlechten.
ZEIT ONLINE: Und was ist das Gute am Homo sapiens?
Fischer: Wenn es richtig heiß wird am Allerwertesten, haben wir uns
immer bewegt. Dann waren wir immer intelligent genug, Lösungen zu
finden. Da bin ich ziemlich optimistisch.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-11/joschka-fischer-nahost-konflikt-israel-hamas-antisemitismus-ukraine/komplettansicht
--
Input mailing list
Input@gruene-linke.de
https://lists.gruene-linke.de/mailman/listinfo/input
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.



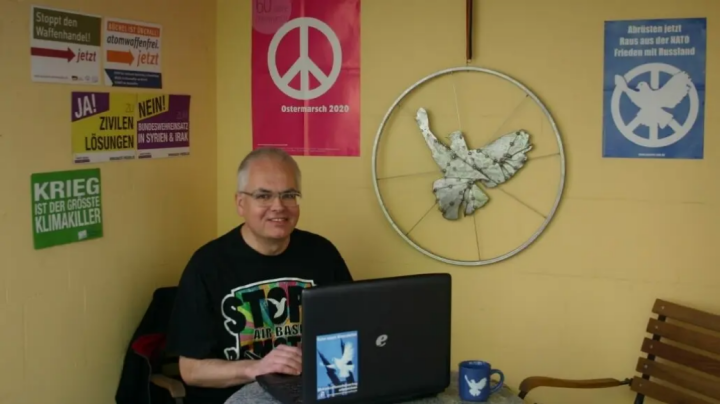
 Quelle: RT © Wladislaw Sankin
Quelle: RT © Wladislaw Sankin