Der Westen und der Iran: Kopflos durch die Macht
freedert.online, vom 28 Apr. 2024 07:30 Uhr, Von Tom J. Wellbrock
Deutsche Medien und Politik steigern sich in ihren geopolitischen Größenwahn immer mehr hinein. Die Folgen der teils irrwitzigen Ideen, die dabei entstehen, interessieren nicht. Das ist nicht nur ein Zeichen von Ignoranz, sondern auch von Dummheit.
 Quelle: Legion-media.ru © Bild:
Quelle: Legion-media.ru © Bild:
item/en/1/ppiphotos418745.157
https://www.legion-media.ru/
Nach Israels Angriff auf ein Konsulatsgebäude in Damaskus steht Iran im Fokus westlicher Aggressionen.
"Wenn wir das System schon nicht stärken, wie können wir es denn schwächen?" Diese Frage stellte der ZDF-Moderator Markus Lanz kürzlich Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD. Der antwortete irgendwas mit Sanktionen und der Unterstützung Oppositioneller. Keiner der anderen Gäste in der Runde stellte Lanz die Gegenfrage: "Mit welchem Recht dürfen wir den Iran schwächen?"
Damaskus: Der verschwiegene Angriff
Aktuell ist Iran im Fokus deutscher Journalisten und Politiker. Alles dreht sich um die Frage, wie auf den Angriff Irans auf Israel reagiert werden sollte. Die Ideen reichen von Sanktionen bis hin zu Bomben, und immer ist der Ausgangspunkt Irans Angriff auf Israel.

Irans Großangriff beschädigt Landebahn auf Luftwaffenstützpunkt Nevatim in Israel
Während in den ersten Tagen nach diesen Attacken Irans hier und da noch angemerkt wurde, dass vor dem Vergeltungsschlag ein völkerrechtswidriger Angriff auf ein Konsulatsgebäude in Damaskus (Syrien) durch Israel verübt wurde, spielt das inzwischen keine Rolle mehr. Der Angriff Israels, der erst zu dem iranischen Gegenschlag führte, ist aus der veröffentlichten Wahrnehmung getilgt worden, um die Sprachregelung "Angriff auf Israel" rechtfertigen zu können.
Erneut stellt Deutschland eindrucksvoll unter Beweis, was es unter Geschichte versteht. Im Falle der Ukraine beginnt diese am 24. Februar 2022, im Fall Israels am 7. Oktober 2023, und jetzt, beim Iran, beginnt sie – nachträglich korrigiert – mit dem 16. April 2024. Unter den Tisch fallen sämtliche Zeiträume vor diesen beschlossenen wichtigen Daten, womit die gesamten Vorgeschichten ebenfalls zu thematischem Staub zerfallen.
Hier geht es natürlich um das "Gut-Böse-Prinzip", das nur aufrechterhalten werden kann, wenn unbequeme Fakten unterschlagen werden. Doch es wäre zu einfach, die westliche Praxis auf moralische Ansprüche zu reduzieren, die allein schon zynisch und doppelmoralisch belegt sind. Beim Kampf gegen Iran spielen weit mehr Dinge eine Rolle, und diese reichen von innenpolitischer Einflussnahme als Mittel im Kampf gegen China und andere BRICS-Länder bis hin zur weltweiten Energieversorgung. Dazwischen liegen zahlreiche weitere Themengebiete, aber diese spielen mit Sicherheit keine Rolle: Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit. Das wäre auch zutiefst unglaubwürdig. Man kann diese Errungenschaften nicht im eigenen Land abschaffen, um sie von anderen zu fordern.

USA sollen über iranischen Angriff auf Israel informiert gewesen sein
Spaß mit Öl und Gas
Dem Westen ist der Iran nicht nur wegen seiner enormen Öl- und Gasreserven ein Dorn im Auge. Es geht um geopolitische Machtstellungen, und bei denen spielen Ressourcen zunächst einmal eine untergeordnete Rolle. Doch beides hängt natürlich eng miteinander zusammen, und wer die beste und billigste Energie erzeugen oder beziehen kann, ist geopolitisch im Vorteil, hat also auch einen Machtvorteil. Daher kann man – egal, von welcher Perspektive aus man die westliche Sicht auf Iran betrachtet – die Bedeutung von Öl und insbesondere Gas nicht außer Acht lassen, wenn man den Iran analysiert.
Die Relevanz von Öl und Gas wirkt in beide Richtungen. Iran verfügt über enorme Reserven, muss diese aber auch auf dem Weltmarkt verkaufen. Es war Donald Trump, der mit seinem Sanktionspaket gegen den Iran das Land in erhebliche Schieflage brachte (Sanktionspakete gegen den Iran werden in unregelmäßigen Wellen geschnürt, Trump hat sie also nicht erfunden, aber besonders radikal umgesetzt). Noch bevor die Corona-Episode die Weltwirtschaft in Bedrängnis brachte, sorgte Trump dafür, dass im Iran der Ölexport um 80 Prozent einbrach, die Wirtschaftsleistung um 12 Prozent und der Reallohn um 14 Prozent absanken. In der Folge stieg die Armut im Iran deutlich, der Mindestlohn kollabierte regelrecht, große Teile des Mittelstandes fielen in die Armut.
Doch während in der Vergangenheit derlei Schocks immer wieder in Regierungsstürzen mündeten, war das beim Iran nicht der Fall. Es führte eher zu einer "Jetzt-erst-recht-Haltung", was auch dadurch begünstigt wurde, dass der inzwischen verarmte Mittelstand keine mäßigende politische Wirkung mehr entfalten konnte. Er war ja regelrecht ausradiert worden.

Leiterin des RT-Nahost-Büros berichtet vor Ort über iranischen Drohnenangriff
Zudem: Eine Begleiterscheinung von Sanktionen sind Mittel und Wege, sie zu umgehen. Dies gelang selbstverständlich auch dem Iran, und so wurden nach und nach die Geschäfte wieder aufgenommen, teilweise im halb- oder vollkommen illegalen Bereich (wenn man denn US-amerikanische Sanktionen als legal bezeichnen möchte), teilweise aber auch durch neue Partnerschaften.
Iran: Kein kleiner Fisch
Man muss bedenken, dass Iran zu den BRICS-Staaten gehört, was einen nicht zu unterschätzenden Vorteil für das Land bedeutet. Iran streckt außerdem schon länger die Hände in Richtung Russland und China aus. 2021 wurde ein weitreichendes Abkommen mit China unterzeichnet, das dem Iran 400 Milliarden Dollar in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und Militär bescherte. Im Gegenzug erhält China Öl und Gas zu günstigen Konditionen.
Kurze Zeit später wurde ein Vertrag mit Russland verlängert, der bereits seit 2001 bestand. Auch hier geht es um umfassende Kooperationen auf Gegenseitigkeit. Das ist der Unterschied zum Umgang des Westens mit Iran. Systeme, die dem Westen nicht passen, will er vernichten und nach seinen Vorstellungen umbauen. Das Prinzip der BRICS-Staaten dagegen ist Kooperation und Zusammenarbeit.
Hier liegt der große Knackpunkt. Weltweit gibt es sehr unterschiedliche politische Systeme. Man muss nicht alle mögen, aber man muss akzeptieren, dass es sie gibt. Veränderungen können am ehesten durch Dialoge und Handel erreicht werden. Und in manchen Fällen ist auch das nicht möglich. Was wäre in Deutschland los, wenn China sich entschließen und das auch offen kommunizieren würde, dass das deutsche politische System marode ist, demokratische Strukturen verschwinden lässt und dementsprechend zerstört werden muss? In Deutschland wäre die Hölle los, die Empörung wäre grenzenlos, Einmischung verbiete sich, würde das vehement vorgetragene Urteil lauten.

Scott Ritter zu Irans Vergeltungsschlag auf Israel: "Ein großer iranischer Sieg"
Iran, China oder Russland müssen sich aber genau diese Vorwürfe durch den Westen gefallen lassen. Und man fragt sich: mit welchem Recht?
Das größte Opfer: die Palästinenser
Seit dem Angriff Israels auf Damaskus hat sich die politische und mediale Aufmerksamkeit verschoben. Die Bedeutung des Iran und die Gefahr einer Ausweitung des kriegerischen Konflikts mit Israel sind selbstverständlich nicht zu unterschätzen, insbesondere weil der Westen großes Interesse daran hat, den Iran mindestens zu schwächen. Mangels diplomatischer Fähigkeiten auf der deutschen Seite und des fehlenden Willens in den USA, eine friedliche Lösung zu finden, ist die Eskalationsgefahr nicht von der Hand zu weisen.
Der Westen, die NATO, Deutschland können gar nicht mehr anders als auf Krieg zu setzen. Das hat nicht zuletzt auch wirtschaftliche Gründe, denn die Wirtschaft mit dem Krieg ist in den zerfallenden westlichen Systemen nach wie vor ein Garant für hohe Umsätze. Und sie ist auf eine zutiefst zynische Weise sogar nachhaltig, denn zerstörte, zerbombte, zerschossene Länder müssen wieder aufgebaut werden, das setzt wirtschaftlichen Spielraum frei. Die Zerstörungswut neoliberaler Politik führt zu wachsender Armut, die Binnenmärkte ächzen unter schwindender Kaufkraft, da kommen zerstörte Städte und Länder gerade recht, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Doch den Menschen in Palästina helfen diese Erklärungen nicht. Sie leiden, verhungern, verzweifeln und sterben. Und während diese unzähligen Schicksale in den letzten Wochen zumindest medial Beachtung fanden, ist diese seit den Debatten um den Iran erheblich zurückgegangen. Die Palästinenser leiden, verhungern, verzweifeln und sterben jetzt also zu Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Blinken nach iranischem Vergeltungsschlag: "Wir streben keine Eskalation an"
Böse Zungen behaupten, Israel habe genau diesen Zweck verfolgt, als es die Angriffe auf das Konsulatsgebäude in Damaskus gestartet hat. Mit weniger Öffentlichkeit ist die völkerrechtswidrige Praxis des Massenmordes einfacher fortzuführen. Doch selbst wenn man nicht von einer bewussten und geplanten Praxis Israels ausgeht, steht außer Frage, dass es im Sinne Israels ist, mit seinen schrecklichen Taten in der Weltöffentlichkeit weniger Beachtung zu finden.
Und es funktioniert: In deutschen Medien spielen die Schicksale der Opfer in Palästina seit Mitte April kaum noch eine Rolle, sie werden maximal thematisch gestreift. Das große Thema ist Iran, und das ist weit mehr als ein Ablenkungsmanöver. Es ist der nächste Schritt des Westens zu einer weiteren Eskalation.
Tom J. Wellbrock ist Journalist, Sprecher, Texter, Podcaster, Moderator und Mitherausgeber des Blogs neulandrebellen.
Mehr zum Thema - Das war's für Israel: Akela hat den Sprung verfehlt
RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.
Info: https://freedert.online/meinung/203685-westen-und-iran-kopflos-durch
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.






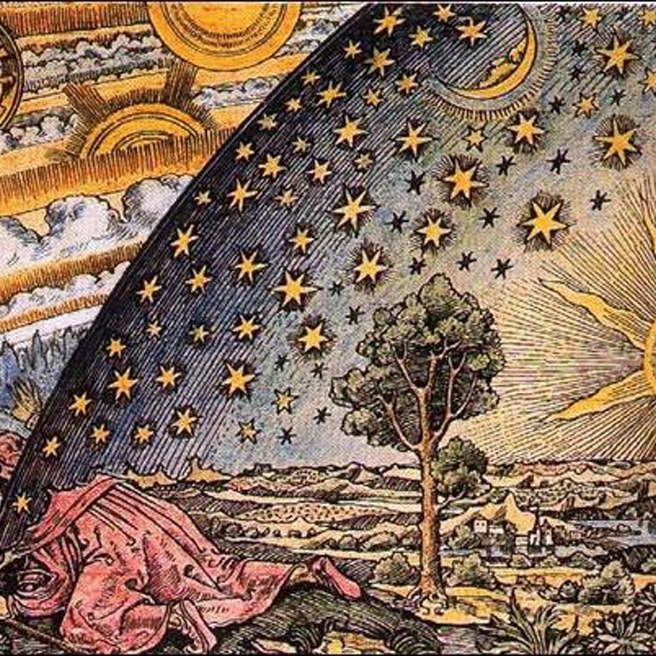 Through A Glass Darkly
Through A Glass Darkly