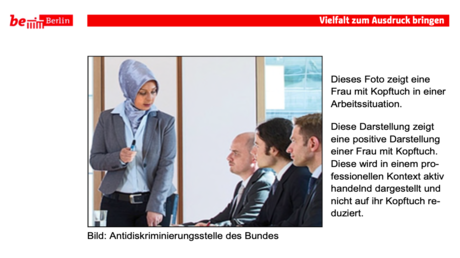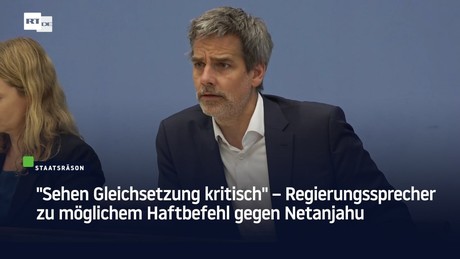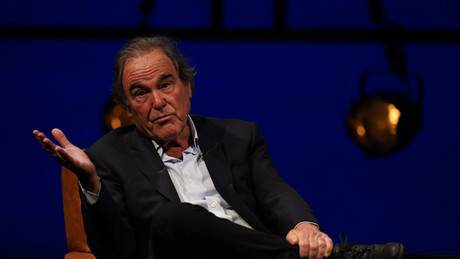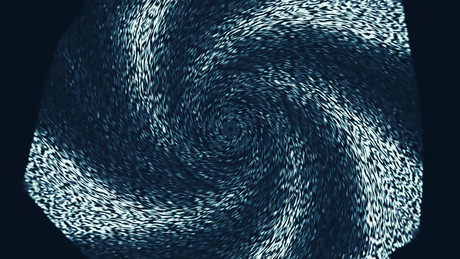aus e-mail von Doris Pumphrey, 26. Mai 2024, 11:10 Uhr
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/ukraine-krieg-robert-habeck-er-wird-zum-lobbyisten-der-deutschen-waffenindustrie-li.2217391
25.5.2024
*Waffen für die Ukraine: Wie Robert Habeck zum Lobbyisten der deutschen
Rüstungsindustrie wurde
*Nicolas Butylin
Robert Habeck befindet sich im Krieg. Mitte April, bei noch kühlen
einstelligen Temperaturen, ist der grüne Bundeswirtschaftsminister zum
insgesamt dritten Mal in die kriegsgebeutelte Ukraine
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/ukraine> gereist. Die Bilder des
54-Jährigen aus dem Schutzkeller in der ukrainischen Hauptstadt gehen
viral – Ukraine-Besuche deutscher Politiker sind allerdings nach mehr
als zwei Jahren Krieg eher Alltag als Ausnahme.
„Solidarität mit der Ukraine“, heißt es in Behörden, Ministerien und
Parteien der Mitte. Doch Habecks Reise speist sich nicht nur aus einer
intrinsischen Kameradschaftlichkeit zum politischen Kiew. Es geht auch
um deutsche Interessen, um die deutsche Wirtschaft
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/wirtschaft> und ihre
Wehrfähigkeit. Wenn man hinschaut, hat der Krieg der deutschen
Wirtschaft geschadet. Doch eine Branche ist im Aufwind: die deutsche
Waffenindustrie.
„Der Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz,
Robert Habeck, ist heute für einen Besuch in der Ukraine eingetroffen.
Dort führt er politische Gespräche und trifft Vertreterinnen und
Vertreter der Wirtschaft“, heißt es im Behördendeutsch auf der Webseite
des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) im April. Dazu schreiben
Dutzende Medien auffallend zurückhaltend und kryptisch, der Minister
werde von einer „Wirtschaftsdelegation“ begleitet.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/wolodymyr-selenskyj> spricht da
weitaus offener über das Treffen mit Habeck. „Es ist wichtig, die
Luftabwehr unseres Landes mit modernen Systemen westlicher Produktion
weiter zu stärken“, schreibt Selenskyj auf X. Er habe gemeinsam mit der
Delegation aus Berlin über die „gemeinsamen Anstrengungen“ im
Wirtschaftsbereich gesprochen. Dann verlautbart Selenskyj: „Wir haben
vereinbart, uns auf den militärisch-industriellen Komplex zu konzentrieren.“
Statt in den – in Anbetracht der militärischen Vorstöße der Russen im
Osten der Ukraine eher fernen – zivilen Wiederaufbau des EU
<-Beitrittskandidaten" rel="noopener">https://www.berliner-zeitung.de/topics/eu>-Beitrittskandidaten zu
investieren, werden deutsche Steuergelder also verstärkt in
deutsch-ukrainische Waffenprojekte fließen. Und dabei sind gewiss nicht
Kurzzeitprojekte wie eine Tranche Munition oder eine Handvoll
Leopard-2-Panzer gemeint. Es geht um längerfristige Kooperationen in der
Waffen- und Munitionsproduktion, in hochtechnologischen
Verteidigungssystemen, in der Cybersicherheit, so Branchenkenner in
Hintergrundgesprächen mit der Berliner Zeitung. Dabei fällt immer wieder
der Begriff des „militärisch-industriellen Komplexes“.
*Warum will Deutschland in den militärisch-industriellen Komplex
investieren?
*Doch was bedeutet dieser Begriff, der in der sicherheitspolitischen
Literatur eher im amerikanischen oder russischsprachigen Raum zu
verorten ist? Der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower warnte in
einer Rede 1961 erstmals vor dem „militärisch-industriellen Komplex“,
kurz MIK, der mit dem Kalten Krieg
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/kalter-krieg> herangewachsen
sei. Der MIK ist – in kurzen Worten – die Verknüpfung und gegenseitige
Interessenverbindung zwischen Politikern, Militärs und Vertretern der
Rüstungsindustrie. Später wurden in gesellschaftskritischen Analysen
auch Militärinstitute und Denkfabriken aufgenommen. Der MIK ist also
eine Art militärpolitisches Fundament für höhere Rüstungsausgaben.
Ein solcher militärisch-industrieller Komplex soll nach Wünschen Robert
Habecks und der Rüstungsbranche nun auch in Deutschland allumfassend
aufgebaut werden. Wer sich dagegen positioniert, sei „aus der Zeit
gefallen“, so der Tenor. Man kann es den Akteuren im Waffenbusiness auch
nicht verübeln, denn alle Seiten profitieren: Die politischen
Entscheidungsträger bekommen Waffen, die Industrie findet neue
Absatzmärkte, die Ukraine erhält dringend benötigte militärische
Unterstützung, während Militärexperten ihre Daseinsberechtigung
bestätigt sehen. Eine Win-win-win-Situation.
Obgleich Militärs und ihre Berater den MIK-Begriff teilweise ablehnen,
wissen auch sie, dass die gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen in der
Verteidigungspolitik in Berlin, Paris
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/paris> und Brüssel zum Thema
Nummer eins geworden sind. Die Europäische Kommission, das Exekutivorgan
der EU, schlägt beispielsweise vor, über eine Milliarde Euro auszugeben,
um den EU-Mitgliedsstaaten Anreize zu schaffen, primär bei europäischen
Unternehmen einzukaufen und nicht außerhalb Europas. Die
Rüstungsindustrie soll hingegen ermutigt werden, neue Technologien zu
entwickeln und die eigenen Kapazitäten stetig weiter zu erhöhen.
Und an genau diesem Aufbau militärisch relevanter Produktionskapazitäten
wollen deutsche Rüstungsunternehmen teilhaben. Vielmehr noch: Während
Deutschland in diesem Sommer Fußball-Europameister werden will, haben
sich ein Großteil des Politikestablishments, Militärs und ihre Berater
das Ziel gesetzt, in wenigen Jahren Waffenexport-Europameister zu
werden. In Branchenkreisen sagt man deshalb voraus, dass der Ausbau
jener Produktionsstätten bis zu vier Jahre dauern werde.
m weltweiten Vergleich zeigt sich jedoch, dass die
militärisch-industriellen Bestrebungen Deutschlands noch in den
Kinderschuhen stecken. Dazu zwei Vergleiche: Laut dem Stockholmer
Friedensforschungsinstitut Sipri liegen die USA
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/usa> mit 42 Prozent aller
weltweiten Waffenexporte fast konkurrenzlos vorne; Deutschland liegt bei
knapp über fünf Prozent. Und auch die Umsätze von amerikanischen
Rüstungskonzernen wie Raytheon oder Lockheed Martin liegen für hiesige
Firmen wie Rheinmetall und Thyssenkrupp außer Reichweite.
Auch Russland <https://www.berliner-zeitung.de/topics/russland> spielt
militärisch in einer anderen Liga als die Bundesrepublik. Dort lag der
Anteil der weltweiten Waffenexporte bei elf Prozent – Russland teilt
sich mit den Franzosen den zweiten Platz. Hinzu kommen die für die
Waffenproduktion großen territorialen Vorteile des geografisch größten
Landes der Erde sowie der gesellschaftspolitische „Freifahrtschein“
unter dem Vorzeichen der Kriegsindustrie und eines Krieges, der für die
Russen existenziell erscheint. Nicht zu vergessen: Das nukleare Arsenal
mit knapp unter 5900 Atomsprengköpfen, die für Interkontinentalraketen,
Atom-U-Boote oder Langstreckenbomber vorgesehen sind. Deutschland hat im
Vergleich dazu keine Atomwaffen – kann sich jedoch, Stand Mai 2024, auf
die westlichen Nuklearmächte Frankreich, Großbritannien und die USA
verlassen.
*Welche Rüstungsfirmen wollen in der Ukraine „Business“ machen?
*Doch schauen wir zunächst zurück auf Habecks bisherige Ukrainepolitik.
Bevor der Grünenpolitiker nämlich – mit eher wenigen Vertretern von
Rüstungsunternehmen wie Diehl Defence, Quantum Systems oder Global
Clearance Solutions – im April in die Ukraine reiste, kam es Ende März
im Wirtschaftsministerium zu einem noch viel brisanteren Auftakttreffen.
Geschäftsführer und ranghohe Gesandte, quasi die Crème de la Crème
deutscher Rüstungsunternehmen, diskutierten an einem Tisch mit Habeck
über „Fragen der nationalen und europäischen Sicherheit und
Wehrhaftigkeit“. Das politische Gebot der Stunde sei es,
„sicherheitsfähig“ zu werden, so der Tenor. Die Weltbedrohungslage habe
sich geändert, sie nicht zu reflektieren sei naiv, so Habeck. Deshalb
solle, so der grüne Vizekanzler, die Waffenproduktion hochgefahren
werden. Im Kern allerdings, so heißt es aus Branchenkreisen, sei es bei
dem Treffen mit führenden Rüstungsunternehmen um die militärische
Unterstützung der Ukraine gegangen.
Mit dabei waren laut Bild-Zeitung auf jeden Fall zwölf Unternehmen,
darunter: Airbus Defense and Space, die militärische Luftsysteme und
Drohnen herstellen; Airbus Helicopters; Rheinmetall
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/rheinmetall>, bekannt für die
Wartung und Instandsetzung von Panzern; Thyssenkrupp Marine Systems, die
Technologien für nicht-nuklear angetriebene U-Boote und Marineschiffe
herstellen; die Renk AG baut Antriebstechniken für militärische
Landfahrzeuge; Helsing, ein Unternehmen, das Künstliche Intelligenz im
Verteidigungssektor nutzt; der Softwaregigant Palantir; die
Funktechnikspezialisten Rhode und Schwarz; die Drohnenhersteller von
Quantum Systems; Schiffbauer von Naval Vessels Lürssen; Raketenbauer von
Diehl Defence und das Rüstungsunternehmen Hensoldt, das sich auf
militärische Technologien spezialisiert hat.
Wie das Handelsblatt berichtete, waren auch das Kanzleramt, das
Auswärtige Amt und Staatssekretäre aus Verteidigungs- und
Finanzministerium bei dem ranghohen Treffen zugegen. Man wolle die
sicherheitspolitische Lage in Anbetracht des Ukrainekrieges um eine
industriepolitische Komponente bereichern. In anderen Worten: In
Deutschland soll auf lange Sicht ein bedeutender
militärisch-industrieller Komplex aufgebaut werden.
Für ein solches Unterfangen haben Rheinmetall, Diehl und Co. allerdings
ihre ganz eigene Wunschliste mitgebracht: Wie gestaltet sich für die
Unternehmen die Planungssicherheit? Schließlich bestehen die Firmen auf
zuverlässige Abnehmer ihrer Rüstungsprodukte. Was kann die
Bundesregierung zur Verfahrensbeschleunigung tun? Hier nimmt sich die
Rüstungsbranche laut Handelsblatt das Tempo beim Bau neuer Terminals für
LNG-Gas als Vorbild.
Zentral war auch die Finanzierungsfrage: Wie kann man Anreize bei
Investoren schaffen und was passiert mit der Schuldenbremse? Wird es zu
einem zweiten Sondervermögen kommen? Denn 80 Prozent aus dem
Sonderbudget sind schon aufgebraucht. Und auch wenn
„Kreditermächtigungen des Sondervermögens im Wesentlichen europäischen
Rüstungsunternehmen zugutekommen“, wie eine Sprecherin aus dem
Finanzministerium sagt, so sagen Branchenkenner, dass insbesondere
amerikanische Konzerne mehrere milliardenschwere Großaufträge
abgewickelt haben.
Außerdem werden nach den aktuellen Planungen die Mittel aus dem
Sondervermögen bis Ende 2027 aufgebraucht sein; ab 2028 sind die
Militärausgaben wieder aus dem Kernhaushalt bereitzustellen, so das
FDP-geführte Finanzministerium. Und wie steht Christian Lindner
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/christian-lindner> überhaupt zu
den Rüstungsambitionen im Wirtschaftsministerium? Mit dem
100-Milliarden-Sondervermögen habe der Finanzminister bewiesen, dass er
unorthodox denken könne, sagt er im Interview mit der
Funke-Mediengruppe. Für das Finanzministerium sei es jedenfalls von
„herausragender Priorität, ausreichend Mittel für die Wehrhaftigkeit der
Bundeswehr bereitzustellen“.
*Was sagen die deutschen Rüstungsunternehmen zum Ukraine-Geschäft?
*Die Unternehmen hierzulande, die für die Ukraine alle Sorten von Waffen
– von der Patronenhülse bis zum Kampfpanzer – herstellen, äußern sich
naturgemäß ungern oder nur sehr verhalten öffentlich zu ihren
Waffengeschäften. Dabei ist die Sparte von hoher volkswirtschaftlicher
Relevanz in Deutschland: Mehr als 130.000 Menschen sind in der
Rüstungsbranche tätig, 30 Milliarden Euro Umsatz werden erwirtschaftet,
Rüstungsaktien an der Börse seien in heutigen Zeiten „eine sichere Bank“.
„Mit umfangreichen Lieferungen und Unterstützungsleistungen für die
Ukraine ist Rheinmetall inzwischen der wichtigste rüstungsindustrielle
Partner des Landes bei seinem Abwehrkampf gegen die russische
Aggression“, heißt es beispielsweise auf der Rheinmetall-Homepage. Der
börsennotierte Düsseldorfer Konzern will bei der Waffenproduktion ganz
vorne mitspielen. Mit der staatlich-ukrainischen Rüstungsvereinigung
Ukroboronprom hat man deshalb im Oktober 2023 ein
Gemeinschaftsunternehmen gegründet: Rheinmetall Ukrainian Defense Industry.
Branchenkenner sagen ganz unverblümt, dass mit dem Ukrainekrieg das
Geschäftsfeld der Waffenindustrie in neue Dimensionen vorgestoßen sei:
Der massive Ausbau von Fabriken könnte sich für die vielen nord-, west-
und süddeutschen Unternehmen auszahlen: niedrige Produktionskosten
gepaart mit einer steten Nachfrage.
Ähnlich sehen die Ambitionen mit dem Ukrainegeschäft in den anderen
deutschen Unternehmen aus: Quantum Systems, ein Hersteller von Drohnen
mit Sitz in Gilching bei München, sucht aktiv nach neuen Mitarbeitern in
der Ukraine. Bei Habecks Ukrainereise im April weihte der
Quantum-Systems-Chef Florian Seibel vor den Toren Kiews ein neues Werk
ein. Bis Ende des Jahres sollen rund 100 Mitarbeiter beschäftigt werden;
darüber hinaus will Quantum Systems in den nächsten zwei Jahren bis zu
sechs Millionen Euro in das Ukrainegeschäft investieren.
Die Sensorenspezialisten von Hensoldt, ein weiteres Unternehmen aus dem
Münchener Landkreis, liefern Hochleistungsradare für die
Luftverteidigung der Ukraine. „Wir sehen in der Ukraine, wie wichtig es
ist, zuverlässig und in hoher Geschwindigkeit aus Daten Informationen zu
gewinnen, die zur Informationsüberlegenheit auf dem Gefechtsfeld
beitragen“, schreibt ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung.
Dabei ist die Ukraine mit einer Bestellung von insgesamt 26
Hensoldt-Radaren TRML-4D der weltweit größte Betreiber dieses Systems.
„Die Technologie von Hensoldt rettet hier jeden Tag Leben und schützt
die Einwohner von Kiew, Odessa und anderen Städten“, so das
Rüstungsunternehmen.
Andere Unternehmen wie zum Beispiel die Renk AG oder Helsing wollen sich
über geschäftliche Beziehungen oder zu ihren Kunden nicht öffentlich
äußern. Einige wenige Unternehmen waren lediglich bereit, sogenannte
Hintergrundgespräche zu führen.
*Was bedeutet die deutsch-ukrainische Kooperation im Rüstungsgeschäft?
*Mit dem Wiederaufbau der Ukraine lässt sich Geld verdienen. Da sind
sich Politiker, Militärs und Unternehmer einig. Die
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem
Marshallplan für die Ukraine; Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirbt für
„eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen“ müsse. Selenskyj sagte in
einer Videoansprache, die Rekonstruktion der Ukraine werde das „größte
Wirtschaftsprojekt unserer Zeit“ in Europa. Der ukrainische Präsident
rechnet mit bis zu einer Billion US-Dollar – so viel soll der
Wiederaufbau der Ukraine in den kommenden Dekaden kosten. Solche Summen
ziehen viele Interessierte an. Waffenlobbyisten sagen hinter
vorgehaltener Hand: In der Ukraine seien „gigantische
Geschäftsmöglichkeiten“ gegeben.
In erster Linie treibe die Rüstungsunternehmen ein – rein ökonomisch
logisches – „kommerzielles Interesse“ an, um in der Ukraine
Waffengeschäften nachzugehen, sagt Severin Pleyer der Berliner Zeitung.
Der wissenschaftliche Mitarbeiter von der Helmut-Schmidt-Universität der
Bundeswehr in Hamburg erklärt jedoch auch, dass die Unternehmen auf
„Wunsch der Bundesregierung“ und ihrer Unterstützungspolitik für die
Ukraine verstärkt im osteuropäischen Land agieren.
In diesem Zusammenspiel aus Politik und Industrie nimmt Robert Habeck
eine eminent wichtige Rolle ein: „Das Bundeswirtschaftsministerium ist
das zentrale Ministerium, das über die Anträge zur Ausfuhr von
Kriegswaffen entscheidet“, so Pleyer. „Reisen wie diese von Minister
Habeck verleihen hierbei der politischen Absicht der Regierung
Nachdruck, die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit zu ertüchtigen.“
Und so hat sich der potenziell nächste Kanzlerkandidat der Grünen zum
Wortführer der deutschen Rüstungsindustrie gemausert. Unter dem Leitwort
der ausgerufenen „Zeitenwende“ sollen nämlich sämtliche Arbeitsbereiche
im BMWK der Ukraine-Unterstützung untergeordnet werden. In den Fluren
des Wirtschaftsministeriums hört man sogar, dass wichtige Aufgabenfelder
im Nahen Osten oder in Nordafrika kaum noch eine Rolle spielen würden.
Nach der überhasteten Suche nach Gas- und Ölalternativen, kurz nach
Beginn des Krieges vor über zwei Jahren, genieße das Rüstungsgeschäft in
der Ukraine im Frühjahr 2024 die mit Abstand höchste Priorität.
Dabei ist es kein Geheimnis, dass die militärischen Hilfsmaßnahmen für
die Ukraine zu einer Hochkonjunktur für die deutsche Waffenindustrie
führen. Denn ein Großteil der 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen
gehen nicht in die Ukraine, sondern in Aufträge an die Rüstungsbranche.
*Welche Strategie verfolgt die Ukraine?
*Allerdings sei das Rüstungsgeschäft zwischen dem politischen Kiew und
der hiesigen Industrie keine Einbahnstraße, sagt der ukrainische
Militärexperte Oleksiy Melnyk im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Der
renommierte Fachmann vom Razumkov-Zentrum, einem Kiewer Think-Tank,
kündigt zwischen Berlin und Kiew eine langjährige Partnerschaft im
Waffensektor an: „Es ist ein weltweiter Trend, dass erfolgreiche
Produktionsfirmen sich internationalen Kooperationen anschließen.“
Melnyk sagt, dass beispielsweise der Deal zwischen Rheinmetall und dem
staatlichen Konzern Ukroboronprom als ein Paradebeispiel für viele
weitere deutsch-ukrainische Rüstungskooperationen dienen wird.
Der Vize-Direktor des Razumkov-Zentrums verweist in diesem Zusammenhang
auf den erst kürzlich erschienenen Sipri-Bericht. Die Ukraine war im
vergangenen Jahr der weltweit größte Waffenimporteur war. Die meisten
Militärpakete bekam Kiew im Zeitraum von 2019 bis 2023 aus den USA (39
Prozent), gefolgt von Deutschland (14 Prozent) und Polen
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/polen> (13 Prozent).
Rheinmetall, Thyssenkrupp, Diehl und Co. können sich laut Melnyk zudem
auf weitere günstige Grundvoraussetzungen in der Ukraine freuen. „Auch
wenn die Zeiten, in denen wir die Waffenkammer der Sowjetunion waren und
Interkontinentalraketen und Gefechtsfahrzeuge en masse hergestellt
wurden, längst vorbei sind, so haben wir – historisch bedingt aus
Sowjetzeiten – mit die weltweit besten Ingenieure, Mechaniker und
Techniker hervorgebracht“. Und eben diese Berufsposten werden von den
Unternehmen massiv gesucht, wie ein Blick in die Stellenangebote bei
Quantum Systems zeigt. Zudem seien die Ukrainer schlichtweg günstigere
Arbeitskräfte als beispielsweise Produktionsstandorte in anderen
osteuropäischen Ländern.
„Nimmt man jedoch all die gutgemeinten Aussagen und
Solidaritätsbekundungen zur Seite, dann ist die Ukraine für die deutsche
Rüstungsbranche natürlich eine Art Testfeld“, sagt Melnyk. „Welche
Systeme funktionieren? Was können wir vom Markt nehmen? Was brauchen die
Geschäftspartner? Nach welchem Tier benennen wir unser nächstes
Produkt?“, seien die Fragen, die unternehmensintern gestellt werden.
Im Interview mit der Berliner Zeitung
<https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/melnyk-deutschland-und-ukraine-koennen-weltspitze-bei-ruestung-werden-li.351083>
äußerte sich auch der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland,
Andrij Melnyk, zur deutsch-ukrainischen Rüstungskooperationen: „Die
Ukraine war vor dem Krieg immer unter den Top 15 der Rüstungsexporteure.
Deutschland hat ebenfalls hervorragende Kapazitäten. Wir könnten diese
Synergien nutzen, um Weltspitze zu werden und modernste Waffensysteme
gemeinsam herzustellen“. Einerseits müsse, so der ehemalige Botschafter,
die Ukraine massiv aufgerüstet werden, um genug Abschreckungspotenzial
zu schaffen und somit neue Aggressionen Russlands zu verhindern.
Andererseits könnten die Ukraine und Deutschland gemeinsam die gesamte
Welt mit den besten Panzern und anderen Waffen beliefern. „Das würde
sowohl den strategischen Interessen unserer beiden Länder entsprechen
als auch der deutschen Rüstungsindustrie einen riesigen Schub geben“, so
Melnyk.
*Krieg ist Geschäft – nicht mehr, nicht weniger
*Der Militärexperte Oleksiy Melnyk sagt zudem, die Ukraine habe in der
jetzigen Lage keine andere Wahl, als eine Art Testfeld für die neueste
Militärtechnik zu sein. Der akute Soldatenmangel, der zermürbende
russische Bomben- und Drohnenterror in frontnahen Städten und
Siedlungen, die Kriegsmüdigkeit unter Ukrainern: Je stärker die Ukraine
in Rüstungsfragen mit Deutschland – aber auch mit anderen Partnern wie
den USA, der Türkei <https://www.berliner-zeitung.de/topics/tuerkei>
oder Frankreich – zusammenarbeitet, desto unabhängiger fühle man sich.
Unabhängiger von Russland. Für sicherheitstheoretische und
philosophische Debatten, ob mehr Waffen auch automatisch mehr Kriege
bedeuten, habe die Ukraine laut Melnyk derzeit keine Kapazitäten.
Robert Habeck und die Grünen, eine Partei, deren Laufbahn sich
ursprünglich aus einem pazifistischen Grundkonsens definierte, sind
derweil nach mehr als 800 Tagen Krieg europaweit zu den unangefochtenen
Wortführern verstärkter Waffenlieferungen avanciert. Das Wählerklientel
unterstützt das – es sind schließlich die Grünenwähler, die in
verschiedensten Umfragen am stärksten immer mehr und immer größere
Waffen für die Ukraine befürworten.
Dabei passen die Klimaziele
<https://www.berliner-zeitung.de/topics/klimawandel> und ambitionierte
Rüstungsprojekte nur schwer zusammen. Der Kampfpanzer Leopard-2
verbraucht auf 100 km etwa 530 Liter Diesel – so viel wie 100
Kleinwagen. Raketen, Panzer und Kampfjets belasten das Klima erheblich.
Doch im Pariser Klimaabkommen tauchen die Waffen nicht auf. Zudem gibt
es für die Rüstungsindustrie keine Berichtspflicht für militärische
Treibhausgasemissionen. Es ist deshalb schwierig, die Mengen an CO2 zu
bestimmen, die die Rüstungsbranche verursacht. Konzerne und Staaten
argumentieren mit der „nationalen Sicherheit“. Wie soll Habeck, der ja
auch Klimaminister ist, diesen Spagat nur schaffen?
Es bleiben viele weitere offene Fragen. Die deutsche Rüstungsindustrie
wird neue Werke in der Ukraine aufbauen, Technologien werden übertragen,
Kooperationen entstehen: Doch was passiert mit all dem (geheimen)
Wissen, falls die Ukraine in zehn oder 15 Jahren plötzlich nicht mehr
zum westlichen Lager gehören sollte? In der Branche stellt man sich
durchaus solche Fragen. Doch diese fallen eher unter den Reiter
„Sonstiges“. Und geht es bei den Rüstungsambitionen um die Verteidigung
der Ukraine oder die Wehrtüchtigkeit Deutschlands? Ein weiterer Gedanke:
Wenn heutzutage Raketenstarts schon aus dem All detektiert werden können
und Raketen effektiv abgefangen werden – wie geschehen beim Angriff des
Iran auf Israel <https://www.berliner-zeitung.de/topics/israel> – warum
sollten dann Panzer noch eine effektive Waffe sein? Dass die ukrainische
Militärführung einen Teil ihrer amerikanischen Abrams-Panzer erst gar
nicht an die Front schickt, da russische Drohnen die Gefährte leicht
zerstören können, sollte mehr als nur eine Randnotiz sein.
Robert Habeck wird sich deshalb im kommenden Wahlkampf stärker mit der
softwarebasierten Rüstungsfrage auseinandersetzen müssen: Vielleicht
profiliert er sich damit sogar. Jedenfalls verspricht der Vizekanzler,
die Interessen der Waffenindustrie ins Zentrum der
Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu rücken, die im Juni in Berlin
stattfinden soll. Neben ranghohen Politikern aus Deutschland und Europa
soll auch Selenskyj in die Hauptstadt kommen. Die CEOs der großen
Waffenkonzerne werden ebenfalls nicht fehlen.
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.