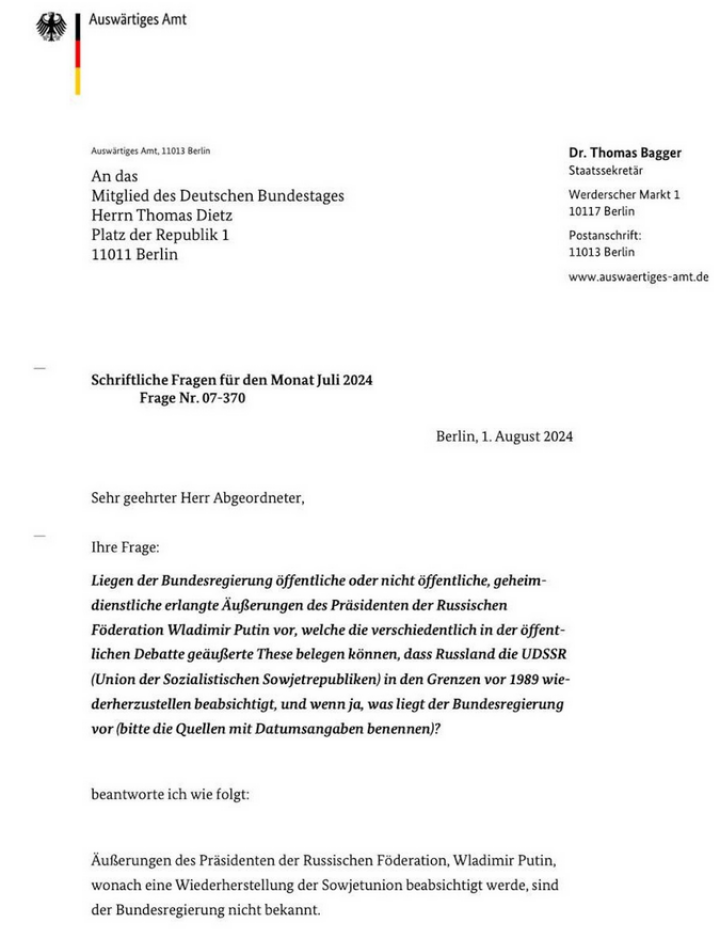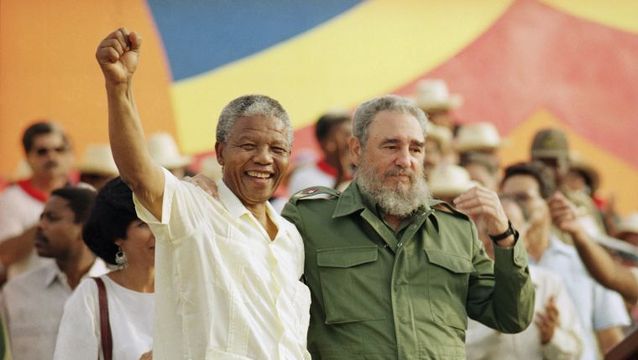makronom.de, 15. August 2024, von André Kühnlenz, Deutschland, The State of Swing
Die Arbeitslosenquote in den USA hat gerade eine kritische Schwelle gerissen. Für Deutschland gilt dies bereits seit 2022. Die Bundesregierung sollte dringend handeln. Ein State of Swing-Blogbeitrag von André Kühnlenz.
Wer wissen will, wie die Konjunktur eines Landes läuft, muss nur auf den Arbeitsmarkt schauen. Diese Erkenntnis gilt zwar besonders für die USA, wo die Unternehmen in Abschwungphasen schneller als in Europa ihre Jobs streichen. Doch auch hierzulande sollte niemand die Daten vom Arbeitsmarkt als nachrangig abtun, wenn es darum geht, die Konjunktursignale zu erkennen.
Entgegen einem Vorurteil lässt sich nicht nur aus sozialen Gründen beim Blick auf den Stellenzuwachs und die Zahl der Arbeitslosen sehr viel über den künftigen Konjunkturverlauf ablesen. Er liefert auch wertvolle Erkenntnisse darüber, ob ein Land an mangelnder Strukturpolitik leidet oder ob nicht doch das zyklische Auf und Ab eine Volkswirtschaft zurückhält. Eine Frage, die seit Monaten die deutsche Wirtschaft plagt.
Die ersten Tage im August haben es jetzt wieder einmal gezeigt: Viele Marktteilnehmer warten förmlich auf Signale vom US-Arbeitsmarkt, damit sie wie eine Herde überfällige Kursübertreibungen (wie zuletzt wohl bei den Mega-Techs) korrigieren können. Wie stark der aktuelle Kursverfall ausfallen wird, hängt aber entscheidend davon ab, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen wird und ob Schocks einen solchen Abschwung verstärken, wenn sie ihn nicht wie die Finanzkrise oder die Pandemie auslösen.
US-Jobreport von Juli löst Doom-Stimmung aus
Nun mögen die Arbeitsmarktdaten in den USA vom Juli, die die neue Doom-Stimmung an Börsen ausgelöst haben, tatsächlich wetterbedingt (weniger Jobaufbau wegen eines Hurrikans) verzerrt gewesen sein. Einige Ökonomen beeilten sich auch, darauf hinzuweisen, dass von einer Wirtschaftskrise bislang jede Spur fehlt. Allerdings: Wenn die Unternehmen ihre Jobs erst einmal abbauen, würde sich die Frage auch niemand mehr stellen.
Ein Blick auf den jüngsten Trend im Jobaufbau in den USA zeigt nämlich, dass die Sorgen der Marktteilnehmer nicht von der Hand zu weisen sind. Die US-Wirtschaft steht am Scheideweg: entweder Rezession, wenn auch vermutlich eher eine milde, oder eine sanfte Landung des Wachstums, die die Grundlage für einen längeren Aufschwung bildet.
Aufschwungsphasen sind in jeder Marktwirtschaft dadurch geprägt, dass die Unternehmen verstärkt investieren. Denn nur wer investiert, kann seinen Marktanteil (und damit Gewinnanteil) halten oder ausbauen. Es reicht also nicht nur, die verschlissenen Maschinen und Geräte zu ersetzen, sondern das Management muss den Kapitalstock erweitern, was eben meist auch einen Stellenaufbau erfordert.
Der Stellenaufbau hängt an den Investitionen
Solange ein Aufschwung läuft, führt die Marktkonkurrenz dazu, dass die Neu- oder auch Nettoinvestitionen der Unternehmen stärker steigen als die Gesamtausgaben einer Volkswirtschaft. Historisch ist dies in den USA sehr gut belegt, wie die Nettoinvestitionsquote zeigt, also der Anteil der Neuinvestitionen an den Gesamtausgaben.
Immer wenn diese Investitionsquote steigt, gibt es auch nennenswerten Jobaufbau. Dies stützt zugleich die Konsumnachfrage, die die Unternehmen mit ihren Investitionen schlussendlich bedienen wollen. Nun zeigt die Geschichte, dass eine steigende Investitionsquote in einem Aufschwung in der Regel mit Jobwachstum von mindestens 1,25% auf Jahressicht einhergeht (vgl. Grafik).
Genau um solche Schwellenwerte drehen sich die aktuellen Konjunktursorgen der Marktteilnehmer. Anders, als US-Notenbankchef Jerome Powell auf der jüngsten Pressekonferenz in einem anderen Zusammenhang meinte, sind sie aber keine zufälligen statistischen Schwellenwerte, die sich ökonomisch nur schwer begründen lassen würden.
Schwelle für das Jobwachstum bei 1,25%
Es ergibt Sinn, dass das Jobwachstum erst ein bestimmtes Tempo erreichen muss, damit der Unternehmenssektor überhaupt verstärkt investiert. Und auch andersherum: Es entstehen nur ausreichend neue Jobs, wenn die Unternehmen verstärkt in neuen Kapitalstock aus Geräten, Maschinen, Fabriken, Patenten oder Fahrzeugen investieren.
Man könnte es auch die Regel „State of Swing“ nennen: Ein geringerer Jobaufbau als grob 1,25% signalisiert in der Regel eine Rezession. Die Regel wurde in der gleichnamigen Blogkategorie – mittlerweile bei Never Mind the Markets untergekommen – schon öfter erwähnt. Zuletzt im September 2022, als wir darauf hingewiesen haben, dass der Jobaufbau in den USA nach der Pandemie so stark ist, dass eine Rezession noch lange nicht ansteht. Auch wenn die Entwicklung der Zinsen vordergründig etwas anderes suggerierte.
Gemäß der Regel „State of Swing“ wachsen seit Juni die Risiken für eine US-Rezession. Damals hatten die Statistiker die Jobzahlen der Vormonate erheblich revidiert: Zuvor sah es noch danach aus, als ob der Jobaufbau oberhalb der Schwelle von 1,25% abprallen würde – was genau dem Soft-Landing-Szenario entsprochen hätte.
Schwelle für die Arbeitslosenquote bei 0,5 Prozentpunkten
Doch nach den Revisionen sieht es danach aus, als ob sich der Jobaufbau nicht beschleunige. Das gestiegene Rezessionsrisiko zeigt sich bereits im Momentum der Arbeitszeit. Damit ist die Wachstumsrate der jüngsten drei Monate gegenüber den drei Monaten zuvor und auf das Jahr hochgerechnet gemeint (vgl. Grafik).
Eine analoge Schwelle ist seit Veröffentlichung der US-Jobzahlen für den Juli in aller Munde. Die Sahm-Regel, die nach der US-Ökonomin Claudia Sahm benannt ist. Die heutige Chefökonomin bei der Investmentgesellschaft New Century Advisors hatte früher bei der US-Notenbank gearbeitet. Ihre Formel ist genau das Spiegelbild zur Regel „State of Swing“: Lässt das Jobwachstum nach, steigt umgekehrt die Arbeitslosenquote.
Konkret schlägt Sahm vor, dass die kritische Schwelle für die Veränderung der Arbeitslosenquote bei 0,5 Prozentpunkten liegt. Dazu vergleicht sie jeweils den jüngsten Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote mit ihrem Tief in den vorherigen zwölf Monaten (also ohne den jeweils aktuellen Monat). Genau diese Schwelle ist nun im Juli gerissen worden mit einem Wert von 0,53 Prozentpunkten.
Eine Rückkopplungsschleife am Arbeitsmarkt droht
Wie ein historischer Vergleich zeigt, geht die Sahm-Regel genau wie die Regel «State of Swing» mit den beschriebenen Schwankungen der Investitionen einher (vgl. Grafik). Dies unterstreicht, dass Notenbankchef Powell sie nicht unbedingt als unökonomisch abtun sollte, wie er es eben auf der jüngsten Pressekonferenz getan hat. Schließlich stagniert die Investitionsquote (ohne den privaten Wohnungsbau) schon seit geraumer Zeit.
Deutlich ernster nimmt die Sahm-Regel Bill Dudley, der ehemalige Chef der Notenbank von New York. Er hatte mit dazu beigetragen, dass die Marktteilnehmer sich derzeit so sehr auf den Schwellenwert von 0,5 Prozentpunkten fokussieren. „Historisch gesehen erzeugen sich verschlechternde Arbeitsmärkte eine sich selbst verstärkende Rückkopplungsschleife“, schrieb er kürzlich in seiner Kolumne für den Finanzinformationsdienst Bloomberg.
Damit meint er Folgendes: Wenn Arbeitsplätze schwieriger zu finden sind, kürzen die Haushalte ihre Ausgaben, die Wirtschaft schwächelt und die Unternehmen reduzieren ihre Investitionen, was zu Entlassungen und weiteren Ausgabenkürzungen führt. „Aus diesem Grund ist die Arbeitslosigkeit nach Überschreiten der Schwelle von 0,5 Prozentpunkten immer viel stärker gestiegen – der geringste Anstieg betrug fast zwei Prozentpunkte von der Talsohle bis zum Höhepunkt.“
Die Sahm-Regel ist kein Krisenauslöser
Doch diesmal könnte sich Dudley irren, denn wie die Investitionsquote der US-Unternehmen zeigt, ist sie seit der Pandemie noch nicht wieder so stark gestiegen, dass sie entsprechend in einer Rezession wieder heftig korrigiert werden müsste. Auch deswegen bestehen noch gute Chancen, dass es bald zu einer „weichen Landung“ ohne Wirtschaftskrise kommen könnte. Und selbst wenn, dürfte der Abschwung wohl eher milde ausfallen – solange allerdings unvorhergesehene Schocks ausbleiben.
Claudia Sahm warnt auch davor, dass die Marktteilnehmer die Regel nicht mechanistisch als Auslöser einer Rezession interpretieren sollten. Die Idee sei eher gewesen, dass die Schwelle der Politik dabei helfen könnte, rasch Schritte zur Unterstützung der Wirtschaft zu beschließen. Da Investoren aber gerne mechanistische Regeln lieben, hat die aktuelle Marktreaktion wohl eher ihr Eigenleben.
Bei einem erwarteten Anstieg der realen (also inflationsbereinigten) US-Staatsausgaben um mehr als 4% und einem staatlichen Haushaltsdefizit im Wahljahr von mehr als 7% des Bruttoinlandprodukts (BIP), dürfte jedenfalls ohnehin wenig Bedarf bestehen, dass die Regierung noch eingreifen sollte.
Deutsche Arbeitslosigkeit steigt bereits kräftig
Ganz im Gegensatz zu Deutschland: Denn die Sahm-Regel ergibt hier einen Schwellenwert sogar von nur 0,133 Prozentpunkten. Um so viel ist die deutsche Arbeitslosenquote zum Beispiel in der technischen Rezession von Ende 2012/Anfang 2013 gestiegen, als zwei Quartale mit BIP-Minus gezählt wurden.
Alle größeren Wirtschaftseinbrüche wie die Finanzkrise oder die Pandemie gingen mit durchaus stärkeren Anstiegen der Arbeitslosenquote einher (vgl. Grafik). Für solche schweren Wirtschaftskrisen bietet die Schuldenbremse explizit die „außergewöhnliche Notsituation“ an, die nationale Schuldenregeln für den Bund vorübergehend außer Kraft setzt.
Nun kann aktuell zwar nicht von einer regelrechten Wirtschaftskrise in Deutschland gesprochen werden. Die mehr als zweieinhalbjährige Stagnation hat aber bereits dazu geführt, dass die Arbeitslosenquote insgesamt um einen Prozentpunkt seit ihrem jüngsten Tief auf 6% gestiegen ist.
Die Zeit ist reif für die Notfallklausel in der Schuldenbremse
Der Anstieg erreicht damit bereits Dimensionen wie in der Finanzkrise und in der Pandemie, als großzügige Kurzarbeitsregelungen die Jobkrise abgefedert hatten. Der Schwellenwert von 0,133 Prozentpunkten wird bereits seit Sommer 2022 gerissen, kurz darauf schrumpfte auch das Jobwachstum unter die 1,25%, die auch hier gemäß der Regel „State of Swing“ gelten.
Es bietet sich also an, dass sich der Bundestag für die Notfallklausel in der Schuldenbremse an der Schwelle von 0,133 Prozentpunkten ausrichtet. Diese könnte man auch die «Keine-Wunder»-Regel nennen, gemäß den Accounts des Autors dieser Zeilen auf den sozialen Medien. Denn eins ist klar, die Arbeitskräftenachfrage schrumpft eben bereits seit Sommer 2022 und keine Wende ist in Sicht (vgl. Grafik oben). Die neuesten Umfragen unter Einkaufsmanagern zeigen sogar, dass im Juli der Jobabbau bereits begonnen hat (vgl. Grafik unten).
Es spricht viel dafür, dass die von Dudley beschriebene Rückkopplungsspirale am Arbeitsmarkt – ausgelöst durch Krieg und Energiekrise – Deutschland längst voll erfasst hat. Auch wenn das Arbeitskräftehorten noch viel überdeckt. Und dies hat dann eher wenig mit mangelnder Strukturpolitik zu tun. Anders als in den USA erfordert dies eine drängende Reaktion der Politik, um eine lange Lähmung zu verhindern. Deutschland kann noch von Glück reden, dass die US-Rezession wohl eher milde verlaufen wird, wenn sie denn kommt.
Zum Autor:
André Kühnlenz ist Redakteur bei der Finanz und Wirtschaft. Auf Twitter: @keineWunder
Hinweise:
Die State-of-Swing-Taktiktafel der Konjunkturanalyse finden Sie hier.
Dieser Beitrag ist ebenfalls im The State of Swing-Blog der Finanz und Wirtschaft erschienen. In Kooperation mit der FuW veröffentlichen wir die Blog-Beiträge auch im Makronom.
Info: https://makronom.de/eine-sahm-regel-fuer-die-deutsche-schuldenbremse-47110?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eine-sahm-regel-fuer-die-deutsche-schuldenbremse
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält
Weiteres:
Konjunktur
Die State of Swing-Taktiktafel
makronom.de, vom 8. Februar 2018, von André Kühnlenz, The State of Swing, Chartbook
Anhand von drei Impulsen lässt sich gut beobachten, in welchem Stadium sich der Konjunkturzyklus gerade befindet. In der State of Swing-Taktiktafel haben wir in Kooperation mit der „Finanz und Wirtschaft“ diese Impulse für 18 Länder bzw. Wirtschaftsräume übersichtlich zusammengestellt.
Konjunkturzyklen treten seit fast 200 Jahren in allen marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften auf. Seit dieser Zeit versuchen Ökonomen zu ergründen, was hinter den Schwankungen der privaten Wirtschaftsleistung steckt – und ob und wie sich Konjunkturkrisen und die damit verbundenen Jobverluste abfedern lassen. Erklärungsversuche reichen von Marktversagen bis hin zu massenpsychologischen Phänomenen, die die Menschen mal mehr ausgeben lassen, mal eher weniger.
Ideologische Motive waren und sind selten von diesen Erklärungsversuchen zu trennen. Sollte der Staat eingreifen, um die marktwirtschaftliche Ordnung zu stützen? Oder reichen die Selbstheilungskräfte des Marktes aus, damit eine Volkswirtschaft von allein (oder höchstens durch minimale Eingriffe des Staates) wieder ins Gleichgewicht findet? Für einige durch Marx geprägte Zeitgenossen naht sogar immer wieder der Untergang des Kapitalismus, sobald eine Rezession ausbricht.
Kein Konjunkturbeobachter wird sich vermutlich gänzlich von seiner ideologischen Einstellung lösen können, selbst dann nicht, wenn er oder sie sich hinter den kompliziertesten Mathemodellen versteckt. Im Blog The State of Swing der Schweizer Zeitung „Finanz und Wirtschaft“ und von „Makronom“ versuchen wir, etwas Licht in den Dschungel aus Interessen und Fakten zu bringen, die sich doch selten sauber voneinander trennen lassen.
Die Grundidee von The State of Swing lehnt sich an die zahlreichen Fußball-Taktikblogs an: Es geht nicht darum, jede kleinste Einzelheit des Geschehens auf dem Platz zu beleuchten – es geht uns um den roten Faden. So wie die Taktikvorgaben des Trainers im Fußball ein Spiel entscheidend prägen, wollen wir die entscheidenden Bewegungen in den Volkswirtschaften nachzeichnen – also die Swings, die über Aufschwung oder Abschwung, über Aufstieg oder Abstieg einer Volkswirtschaft entscheiden.
Kapitalimpuls, Profitimpuls, Kreditimpuls
Dabei liegt das Augenmerk oftmals auf drei für die konjunkturelle Entwicklung wesentlichen Impulsen, die weiter unten genauer erklärt werden: dem Kapitalimpuls, dem Profitimpuls und dem Kreditimpuls. Mittlerweile sind die Statistiken der meisten Länder zumindest in Europa und Nordamerika so gut, dass wir diese drei Impulse sehr genau und nah am aktuellen Rand entlang nachvollziehen können. Die folgende Übersicht zeigt die Daten für 18 Länder bzw. Wirtschaftsräume – sie ist also eine Art Taktiktafel der Konjunkturanalyse:
USALine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.15 to 3.12.
End of interactive chart.
Euroraum (ohne Irland)Line chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.63 to 1.55.
End of interactive chart.
DeutschlandLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.95 to 2.56.
End of interactive chart.
GroßbritannienLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.43 to 3.56.
End of interactive chart.
FrankreichLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.49 to 2.8.
End of interactive chart.
ItalienLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.37 to 2.62.
End of interactive chart.
SpanienLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.6 to 5.09.
End of interactive chart.
NiederlandeLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.51 to 12.71.
End of interactive chart.
SchweizCombination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.42 to 2.28.
End of interactive chart.
Eurozone ohne Deutschland/IrlandLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.07 to 2.06.
End of interactive chart.
SchwedenLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.66 to 6.96.
End of interactive chart.
PolenLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-02-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.38 to 9.42.
End of interactive chart.
BelgienLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.15 to 13.54.
End of interactive chart.
ÖsterreichLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.02 to 2.46.
End of interactive chart.
IrlandLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -46.53 to 29.56.
End of interactive chart.
FinnlandLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.04 to 6.65.
End of interactive chart.
Tschechische RepublikLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2019-08-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.19 to 7.64.
End of interactive chart.
GriechenlandLine chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-02-15 00:00:00 to 2018-11-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.42 to 8.58.
End of interactive chart.
Anmerkung: Hier finden Sie genauere Angaben zur Datenbasis und Berechnungsweise. Grau: Rezessionen. Quellen: Makronom / Finanz und Wirtschaft / @keineWunder
Was genau aber sagen uns diese drei Impulse? Gehen wir sie der Reihe nach durch.
Kapitalimpuls
Wir wissen, dass die Ausgaben eines Landes für Kapitalgüter (Maschinen, Anlagen, Geräte, Patente, Wirtschaftsgebäude etc.) oft die entscheidende Rolle dafür spielen, ob eine Volkswirtschaft floriert oder nicht. Deswegen wollen wir diese Investitionsausgaben als Kapitalimpuls darstellen.
So beginnt ein Aufschwung meistens damit, dass die Unternehmen ihre Ausgaben für Neuinvestitionen schneller ausweiten und dabei auch ihren bestehenden Kapitalstock durch neue Geräte usw. modernisieren. Investieren die Unternehmen in neuen Kapitalstock, bauen sie dabei auch regelmäßig neue Jobs auf, was wiederum garantiert, dass die private Konsumnachfrage zulegt. Schließlich bedeuten mehr Arbeitsplätze auch mehr Konsumenten, die dann all die Güter und Dienstleistungen kaufen, die von den Unternehmen produziert werden.
Damit kommen wir zur ersten wichtigen Frage, die wir immer wieder stellen können: Weiten die Unternehmen ihre Investitionen im Aufschwung so kräftig aus, dass diese schneller wachsen als ihr gesamtes Einkommen? Dies lässt sich ganz einfach beobachten, indem wir uns das Verhältnis der Neuinvestitionen zum Nettoeinkommen (Nettowertschöpfung) anschauen. Steigt diese Investitionsquote, wollen wir dieses Phänomen einen positiven Kapitalimpuls nennen.
Lenken wir den Blick auf die gesamte Volkswirtschaft, werden wir oft feststellen, dass der Rest der Einkommensgrössen im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt sinkt, wenn die Investitionsquote steigt: Das sind dann vor allem die Konsumausgaben oder die Staatsausgaben. Da dies eine mathematisch-logische Entwicklung ist (alle Quotenänderungen ergeben immer null), reicht es für den schnellen Überblick also, sich auf die Investitionsquote der Unternehmen zu konzentrieren und zu schauen, ob sie einen positiven Kapitalimpuls signalisiert.
Beobachten wir aber über den Verlauf eines Aufschwungs einen steigenden Anteil der Investitionen und einen sinkenden Anteil der Konsumausgaben, dürfen sich alle diejenigen Konjunkturforscher und Ökonomen bestätigt fühlen, die im relativen Zurückbleiben des Konsums die eigentliche Ursache für jede Rezession ausmachen.
Profitimpuls
Auf der anderen Seite sind es auch die Investitionen in den Kapitalstock, die die Produktivität der Unternehmen verbessern. So können die Unternehmen am effektivsten ihren Gewinn steigern, während sie fortlaufend neue Beschäftigte einstellen und die Löhne erhöhen. Deswegen sind die operativen Gewinne der zweite wichtige Impuls, den wir hier beobachten wollen. Schliesslich sind die Gewinnmargen das wichtigste Signal, das darüber entscheidet, ob sich weitere Investitionen lohnen.
Wir wollen hier aber die operativen Gewinne nicht ins Verhältnis zum Umsatz setzen, sondern wie schon vorher beim Kapitalimpuls zum Einkommen der Unternehmen (also Gewinn- und Lohnsumme). Nicht überraschen sollte es uns also, wenn die operativen Gewinne im Aufschwung schneller wachsen als die Lohnsumme und damit natürlich auch das gesamte Einkommen. Ablesen können wir das an der Quote der Profite gemessen am Nettoeinkommen (Nettowertschöpfung), die im Aufschwung steigt und damit einen positiven Impuls liefert.
Zu beachten ist allerdings, dass die operativen Gewinne immer nur die Gewinnsumme messen können, die sich aus der Produktion an einem Standort ergibt – wenn die Unternehmen also ihre Produktion auf den inländischen oder den ausländischen Märkten verkaufen. Was hier nicht mit eingeht, sind Finanzergebnisse, die aus Anlagen in Aktien oder Anleihen oder aus ausländischen Direktinvestitionen resultieren. Der Profitimpuls gibt damit zwar den entscheidenden Trend einer Volkswirtschaft wieder, jedoch sollten wir im Hinterkopf behalten, dass gerade Großkonzerne eine reale Gewinnflaute in einer Volkswirtschaft auch durch gute Entwicklungen am Finanzmarkt oder an Auslandsstandorten ausgleichen können.
Kreditimpuls
Eng verflochten mit dem Kapital- und dem Profitimpuls ist der Kreditimpuls. Denn wenn schon die Investitionen und die Profite schneller wachsen als das Einkommen, muss es einen Mechanismus geben, der den Kapitalaufbau über die laufenden Einkommen hinaushebt. Und das kann durch einbehaltene Gewinne geschehen, die Ersparnis eines Landes oder aus dem Neukreditgeschäft, bei dem die Banken neues Geld schaffen. Deswegen beobachten wir das Verhältnis der Nettokreditflüsse der Unternehmen zu ihrer Nettowertschöpfung. Steigt es, haben wir wieder einen positiven Kreditimpuls.
Ein roter Faden für die Konjunkturentwicklung
Der Kapitalimpuls, der Profitimpuls und der Kreditimpuls können uns also dabei helfen, den roten Faden der Konjunkturentwicklung zu erfassen. Eine Rezession zum Beispiel ist sehr oft dadurch charakterisiert, dass der Kapitalimpuls negativ wird. Das heißt nichts anderes, als dass die Neuinvestitionen schrumpfen, oder wenn sie noch wachsen, dann auf jeden Fall langsamer als das Einkommen. Alle drei Impulse müssen aber nicht unbedingt immer im Gleichlauf zusammenhängen. Mal dreht der eine früher ins Positive, mal läutet der andere den Abschwung oder den Aufschwung ein.
Und natürlich können die drei Impulse eine detailliertere Analyse der zahlreichen volkswirtschaftlichen Größen oder der Bewegungen auf den Finanzmärkten nicht ersetzen. Gleichwohl kristallisieren sich all diese Entwicklungen wie in einem Brennglas in den drei Impulsen. Daher sind sie auch die Grundlage unserer Taktiktafel der Konjunkturanalyse. Sie liefern allerdings umso klarere Signale, je grösser die Wirtschaftsräume sind, die wir hier beobachten.
Vor einem sollte man sich aber noch hüten: So gilt zwar der Zusammenhang, dass fast jede Rezession mit einem negativen Kapitalimpuls einhergeht. Doch es gibt hier keine Automatismen. Denn manchmal erfasst eine Investitionsflaute nur einen kleinen Teil einer Volkswirtschaft, der sich aber umso heftiger in den Makrozahlen spiegelt – wie zuletzt ab 2015 in den USA, als es vor allem die Schieferöl- und -gasbranche traf.
Bleibt der Rest der Wirtschaft aber stabil und baut weiter Jobs auf, laufen die Geschäfte an den Auslandstandorten immer noch gut, muss eine sinkende Investitionsquote oder Gewinnquote nicht unbedingt in eine Rezession führen. Doch dies scheinen tatsächlich nur Ausnahmen zu sein. Wird der Kapitalimpuls negativ, oder sieht es so aus, als könnte er bald drehen, kann er uns in der Regel als Warnsignal für eine nahende Wirtschaftskrise dienen. Gleichwohl müssen wir uns auch immer die konkrete Entwicklung anschauen, wie sie sich in den üblichen Wachstumsraten im Detail abzeichnet.

Zum Autor:
André Kühnlenz ist Redakteur bei der Finanz und Wirtschaft. Außerdem bloggt er auf weitwinkelsubjektiv.com. Auf Twitter: @keineWunder
Hinweis:
Dieser Beitrag ist ebenfalls im The State of Swing-Blog der Finanz und Wirtschaft erschienen. In Kooperation mit der FuW veröffentlichen wir die Blog-Beiträge auch im Makronom.
Info: https://makronom.de/die-state-of-swing-taktiktafel-2-25092
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält







 Quelle: AP © Ohad Zwigenberg
Quelle: AP © Ohad Zwigenberg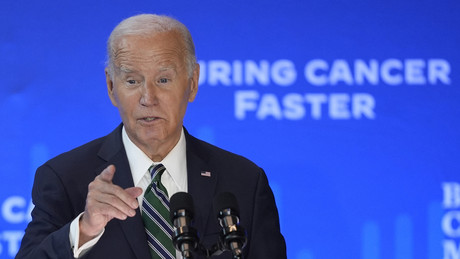












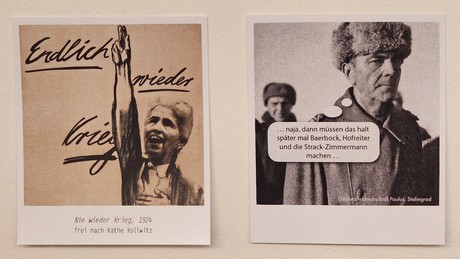


 © Screenshot: faz.net
© Screenshot: faz.net