6. Focus: Schürt unnötig Putin-Panik: Alarm-Aussage zu „letztem Friedenssommer“ ist überzogen
https://www.focus.de/politik/ausland/neitzels-aussagen-zum-letzten-friedenssommer-foerdern-kriegspanik_905279b9-0848-47f0-8bb4-74a3f30c1b43.html
Gastbeitrag von Wolfgang Richter
Schürt unnötig Putin-Panik: Alarm-Aussage zu „letztem Friedenssommer“ ist überzogen
Mittwoch, 26.03.2025, 11:55
Sönke Neitzels Aussagen zu einem bevorstehenden Krieg mit Russland
sind überzogen. Moskau fehlt es an militärischer Stärke und Absichten
für einen Angriff. Statt Panik zu schüren, braucht es Diplomatie für
Sicherheit.
Sönke Neitzels Aussagen zu einem bevorstehenden Krieg mit Russland
(womöglich jetzt „letzter Friedenssommer“) sind völlig überzogen und
unverantwortlich, denn sie verunsichern die Bevölkerung und schüren
Kriegspanik. Sie entbehren einer nüchternen Analyse der militärischen
Fähigkeiten und politischen Absichten Moskaus.
Russland fehlen die militärischen Fähigkeiten für einen Angriff auf Europa
Für einen kurzfristig oder 2029 bevorstehenden Angriff auf Europa
fehlen Russland die militärischen Fähigkeiten. Zwar ist die russische
Wirtschaft zur Kriegsproduktion übergegangen, doch ist der hohe
Ausstoß an schweren Waffen vor allem auf die Instandsetzung älterer
Lagerbestände zurückzuführen.
Sie sollen die hohen materiellen Verluste im Krieg gegen die Ukraine
ersetzen. Nun neigen sie sich dem Ende entgegen.
Die russische Armee hat drei Viertel ihrer Landstreitkräfte im
Ukrainekrieg gebunden und selbst aus der baltisch-finnischen Region
Kräfte abgezogen.
Sie hat es in drei Jahren Krieg nicht geschafft, die Ukrainer
entscheidend und nachhaltig zu besiegen oder auch nur die ukrainische
Luftverteidigung niederzuringen, um die uneingeschränkte
Luftherrschaft zu erzwingen. Im Schwarzen Meer musste sich die
russische Flotte sogar in das östliche Küstengebiet zurückziehen.
Zwar ist Kiew vor allem wegen des akuten Personalmangels in eine
schwierige Lage geraten; und in Kursk und im Donbas neigt sich die
Waagschale jetzt zugunsten der Russen; aber ihre begrenzten
Landgewinne haben sie mit hohen Verlusten erkauft und noch immer haben
sie nicht einmal das Minimalziel erreicht, nämlich die Kontrolle über
die Verwaltungsgrenzen des Gebietes Donezk.
Die europäische Nato wäre Russland konventionell überlegen, auch ohne
USA und Türkei
Auch wenn es noch im ersten Halbjahr 2025 zu einem Waffenstillstand
kommen sollte, was keineswegs sicher ist, werden die russischen
Streitkräfte noch über lange Zeit in der Ukraine gebunden bleiben.
Denn sie müssen dem Risiko begegnen, dass die Ukrainer in einer
günstigeren Lage die Kampfhandlungen wieder aufnehmen.
Mit welchen Kräften sollen denn nun die Russen sich auch noch gegen
das stärkste Militärbündnis der Welt wenden? Selbst die europäische
Nato ohne die USA und die Türkei wäre den russischen Streitkräften in
allen klassischen konventionellen Kategorien wie Kampfpanzer,
Schützenpanzer, Artillerie, Kampfflugzeuge überlegen.
Mit einem Angriff auf Nato-Staaten würde Russland das Risiko eines
großangelegten militärischen Konflikts mit 32 Staaten
heraufbeschwören, darunter mit drei Atommächten.
Solche Risiken eignen sich nicht für ein „Testen“ (Carlo Masala).
Gleichwohl verkennt meine Bewertung keineswegs, dass Europa und vor
allem die Bundeswehr Ausrüstungsmängel und Fähigkeitslücken schließen
müssen, um die Abschreckung auch langfristig zu erhalten.
Sicherheitsbedenken der russischen Eliten
Auch eine entsprechende politische Absicht Moskaus, europäische
NATO-Länder anzugreifen, ist nicht nachweisbar. Im Gegenteil, die
russische Führung hat diese Diskussion in Europa als Unsinn
bezeichnet.
Dass möglicherweise dieses Ziel bestehen könnte, ist eine
Interpretation, die von einigen Think-Tanks auch in Deutschland
gepflegt und mit selektiven Zitaten aus russischen Meinungsbeiträgen
unterfüttert wird.
Solche Theoriegebäude sind jedoch ungeeignet, um eine strategische
Analyse zu ersetzen und einen bevorstehenden russischen Angriffskrieg
gegen NATO-Europa zu prognostizieren.
Es geht vielmehr im Kern um das, was wir in über 30 Jahren Diplomatie
mit Russland erfahren haben, was die strategischen Eliten dort
umtreibt, mit oder ohne Putin, nämlich um russische
Sicherheitsbedenken.
Deren Risikoperzeptionen mag man teilen oder nicht; aber sie sind real
und der Stoff für Diplomatie und im besten Fall für gegenseitige
Rüstungskontrolle.
Die Konsequenz daraus ist es jedoch, einen neuen Dialog über die
zukünftige europäische Sicherheitsordnung zu suchen, statt ihn zu
verweigern, ihn als „Appeasement“ oder gar „Verrat“ zu brandmarken und
Kriegspanik zu schüren. Ein diplomatischer Ansatz könnte die
Bemühungen um einen Waffenstillstand stärken.
Die Kriegshysterie entspringt dem Selbstzweifel
Tatsächlich ist der Kern der zunehmenden Kriegshysterie der
Selbstzweifel in manchen Nato-Staaten, ob wir Europäer und die USA
noch zu unseren Beistandsverpflichtungen nach Artikel 5 des
Nato-Vertrags stehen.
Dieser Zweifel ist nicht neu. Um ihm zu begegnen und die Abschreckung
zu stärken, hat die Nato bereits seit 2014 die Luftverteidigung über
den baltischen Staaten und Polen verstärkt und dort multinationale
Kampfgruppen stationiert.
Deutschland hat dabei eine besondere Verantwortung für Litauen
übernommen und zugesagt, die schon präsente Kampfgruppe unter
deutscher Führung zu einer dauerhaft stationierten Kampfbrigade zu
erweitern.
Dies bedeutet, dass ein russischer Angriff sofort auf Verbände von
über 20 Nato-Staaten einschließlich der Atommächte USA, Großbritannien
und Frankreich stoßen würde. Daran hat sich bisher auch unter der
Trump-Regierung nichts geändert.
Die Kommando- und Streitkräftestrukturen der Nato arbeiten unverändert
wie vorher, einschließlich der wichtigen amerikanischen Führungs- und
Fähigkeitsbeiträge.
Russland ist für Trump nur noch ein Störfaktor
Richtig ist zweifellos, dass Trump sich auf den Hauptrivalen China
konzentrieren will und dazu eine andere militärische und finanzielle
Lastenverteilung zugunsten der USA sucht.
Dass die Europäer mehr Lasten schultern sollen, ist nicht neu und seit
Obamas „pivot to Asia“ bekannt. Dies wird in den USA
parteiübergreifend geteilt. Wir sollten also nicht überrascht sein.
Neu ist allerdings, dass Trump Russland nicht mehr als Hauptrivalen
sieht, sondern nur noch als Störfaktor. Er bewertet den Krieg in der
Ukraine als unnütze Vergeudung von Ressourcen, die er in eine andere
Richtung lenken will.
Dazu möchte er den Krieg rasch und gesichtswahrend beenden und einen
diplomatischen Ausgleich mit Russland suchen. Vielleicht hofft er
auch, dadurch Russland von China entfremden zu können.
Zudem geht es für die USA darum, die strategische nukleare Stabilität
zu wahren. Der New Start-Vertrag läuft im Februar 2026 aus. Ein Ersatz
dafür ist noch nicht in Sicht. Aber Trump will offenbar einen neuen
nuklearen Rüstungswettlauf verhindern. Dazu hat er mit Russland
vereinbart, die strategischen Stabilitätsgespräche nun formell
wiederaufzunehmen. Dies war auch bisher bilateralen Verhandlungen
vorbehalten.
Ohne Russland ist eine europäische Friedensordnung nicht möglich
Für Europa könnte sich als Folge der Neuausrichtung der US-Politik ein
Fenster der Gelegenheit öffnen. Es muss darum gehen, eine dauerhafte
und stabile europäische Friedensordnung wiederherzustellen, die mehr
ist als eine instabile Dauerkonfrontation. Sie ist ohne Russland nicht
zu erreichen.
Statt sich in die „Festung Europa“ einzuigeln, wären also
diplomatische Initiativen geboten, um im europäischen
Sicherheitsinteresse an einer kooperativen Ordnung zu arbeiten.
Eine solche Ordnung ist nach dem Ende des Kalten Krieges schon einmal
erfolgreich umgesetzt worden. Sönke Neitzel sollte diese Zusammenhänge
analysieren, statt Kriegspanik zu schüren.
Über den Gastautor
Wolfgang Richter ist ein deutscher Oberst a.D. und war
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) in Berlin, konkret in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik.
Inzwischen arbeitet er als Associate Fellow beim Genfer Zentrum für
Sicherheitspolitik (GCSP).
——
Den nachfolgenden Kommentar halte ich für
sicherheitspolitisch höchst gefährlich - und
möchte daher Leserbriefe an die FAZ empfehlen.
https://www.frankfurterallgemeine.de/kontakt/herausgeber
Auf der FAZ-Homepage steht der Artikel hinter einer Bezahlschranke:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/der-zwei-plus-vier-vertrag-beschraenkt-deutschlands-moeglichkeiten-110375172.html
Unter dem folgenden Link ist er vollständig lesbar:
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/kommentar-zum-zwei-plus-vier-vertrag-fesseln-noch-gerechtfertigt/ar-AA1Bytk9
Kommentar zum Zwei-plus-vier-Vertrag:
Fesseln noch gerechtfertigt?
Artikel von Reinhard Müller
24.3.2025
Frei ist, wer sich nicht fesseln lässt. Das schließt selbst gesetzte
Bindungen nicht aus. Aber auch von denen kann man sich auf
vorgesehenem Wege lösen. Das geschieht zurzeit durch die deutsche
Volksvertretung im Wege von Verfassungsänderungen aufgrund akuter
Bedrohungen.
Nicht vergessen werden sollte aber auch, die internationalen Bindungen
zu überprüfen. Auch das geschieht schon, wenn etwa über Reformen des
europäischen Asylsystems gesprochen wird. Doch was ist mit der
außenpolitischen Handlungsfähigkeit, wenn der amerikanische
Schutzschirm fehlt und die (atomaren) Fähigkeiten anderer
Bündnispartner nicht ausreichen oder gar nicht zur Verfügung stehen?
Deutschlands Rechtslage bietet hier eine Besonderheit und ein
Lehrstück. Denn es erlangte seine staatliche Einheit und seine volle
Souveränität erst durch den Zwei-plus-vier-Vertrag zurück, den Vertrag
über die „abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“.
Dieses Abkommen zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier
Hauptsiegermächten des Zweiten Weltkriegs, die anfangs das besiegte
Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt und teils unter vorläufige
Verwaltung gestellt hatten, beendete 1990 gleichsam die
(Nach-)Kriegszeit.
Eine Obergrenze für deutsche Streitkräfte
Die Siegermächte annektierten das Land nicht, machten auch kein
Agrarland aus dem vormaligen Aggressorstaat, der schwerste Verbrechen
begangen hatte. Das sollte immer vor Augen haben, wer heute sogar vom
Aggressionsopfer Ukraine endgültige Gebietsabtretungen an den
Aggressor Russland fordert.
Deutschland verlor letztlich ein Viertel seines Staatsgebiets
endgültig erst mit dem Zwei-plus-vier-Vertrag – es gewann aber die von
vielen lange nicht mehr für möglich gehaltene Vereinigung von
Bundesrepublik und DDR und staatliche Souveränität – in freier
Selbstbestimmung, aber zu einem Preis, der über die Ostgebiete
hinausging. Deutschland verpflichtete sich nämlich auf den Verzicht
von atomaren, biologischen und chemischen Waffen und auf eine
Obergrenze seiner Streitkräfte von 370.000 Soldaten.
Die Bundesrepublik hatte sich schon zuvor vertraglich verpflichtet,
auf solche Waffen zu verzichten. Doch seitdem ist es zusätzlich durch
einen mehrseitigen Vertrag gebunden. Ein Kündigungsrecht ist nicht
vorgesehen. Eine Änderung ist grundsätzlich nur durch alle
Vertragsstaaten möglich.
Wollte also Deutschland eigene Atomwaffen entwickeln oder erwerben
oder die Bundeswehr, sagen wir, wieder auf 500.000 Soldaten aufstocken
(so stark war am Ende des Kalten Krieges die alte Bundeswehr der
Bundesrepublik), so brauchte es die Zustimmung der USA,
Großbritanniens, Frankreichs – und Russlands.
Abhängigkeit von Russland
Also jenes ständigen Mitglieds des UN-Sicherheitsrats, das einen
Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine führt und weitere Staaten
bedroht. Es gäbe gute Gründe, hier von einem Wegfall der Grundlage für
den Zwei-plus-vier-Vertrag zu sprechen, einer wesentlichen Änderung
der Umstände, solange Deutschland sich durch die Beschränkungen des
Vertrages nicht mehr wirksam verteidigen könnte.
Würde Deutschland sich darauf berufen, stellte sich allerdings die
interessante Folgefrage, wie es die anderen, die westlichen
Vertragsparteien damit hielten, Deutschland aus den Bindungen des
Zwei-plus-vier-Vertrages zu entlassen. Es ist schließlich etwas
anderes, einem Verbündeten anzubieten, ihn mit unter den eigenen
Atom-Schirm zu nehmen und ihm zu versichern, ihn mit zu schützen, wie
das Frankreich gegenüber Deutschland tut – oder ihm zu erlauben,
selbst Atommacht zu werden.
Was sagen Amerika, Frankreich und Großbritannien?
Somit kommt es also auch für die Verbündeten zum Schwur. Der größte
unter ihnen stellt freilich neuerdings das westliche Bündnis
unverhohlen und wiederholt selbst infrage, indem er etwa
Gebietsansprüche gegenüber Dänemark äußert, den Einsatz militärischer
Gewalt gegenüber einem NATO-Partner nicht ausschließt und Kanada wie
einen (künftigen) US-Bundesstaat anspricht.
Wer wie Deutschland in letzter Zeit sich gern als völkerrechtlicher
Musterknabe geriert (und sich dabei durchaus auch verheddert, siehe
Israel und den Internationalen Strafgerichtshof), der muss eine
Loslösung von – gar multilateralen – Verträgen mit Augenmaß prüfen.
Denn das Signal darf nicht sein: Verträge gelten nichts mehr. Eine
Bindung freilich, die dem Land schadet oder nur einem Gegner und
bisherigem Vertragspartner dient, könnte keinen Bestand haben.
Deutschland stellt keine Menschenrechte infrage, keine Grenzen, nicht
die territoriale Integrität anderer Staaten. Im Gegenteil: Es schützt
sie. Es darf dabei aber selbst nicht untergehen. Die Verteidigung der
eigenen Existenz in Freiheit – was ist gerade unter einer
„wertebasierten Außenpolitik“ wichtiger?
—
Hier noch einmal der Link für Protest-Leserbriefe:
https://www.frankfurterallgemeine.de/kontakt/herausgeber
——
7. Der Spiegel: Krieg in Nahost - Israels Armee greift erneut Militärstützpunkte in Syrien an
https://www.spiegel.de/ausland/israel-armee-greift-erneut-zwei-militaerstuetzpunkte-in-syrien-an-a-a6341cf0-1ff7-4625-b38c-76a1da0fe9b0
Krieg in Nahost - Israels Armee greift erneut Militärstützpunkte in Syrien an
Um Waffenbestände zu zerstören, hat Israels Armee zwei militärische
Einrichtungen in Syrien bombardiert. Derweil versuchten jemenitische
Huthi-Milizen, den Flughafen von Tel Aviv zu beschießen.
25.03.2025, 08.10 Uhr
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben binnen weniger Tage
erneut zwei Militärstützpunkte in Syrienangegriffen.
Es seien »militärische Einrichtungen getroffen« worden, »die in den
syrischen Militärstützpunkten Tadmur und T4 verblieben sind«, erklärte
die israelische Armee am Dienstag mit Bezug auf eine Militärbasis in
Palmyra und einen etwa 50 Kilometer westlich der zentralsyrischen
Stadt gelegenen Militärstützpunkt.
Bereits am Freitagabend hatte Israel die beiden Stützpunkte ins Visier genommen.
Seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad
im vergangenen Dezember hat Israel Hunderte Luftangriffe in Syrien
geflogen, um die dortigen Waffenbestände zu zerstören.
Die Regierung Netanyahu will dadurch nach eigenen Angaben verhindern,
dass strategische Waffen in feindliche Hände fallen. Zudem verlegte
Israel Soldaten in eine von Uno-Truppen überwachte Pufferzone in den
umkämpften Golanhöhen.
Schon vor dem Ende der Assad-Herrschaft hatte Israel während des
syrischen Bürgerkriegs Hunderte Luftangriffe geflogen und dabei
überwiegend Regierungstruppen und mit dem Iran in Verbindung stehende
Ziele angegriffen, darunter Waffenlager der proiranischen
Hisbollah-Miliz im Libanon.
Rakete aus dem Jemen abgefangen
Derweil haben die jemenitischen Huthi-Rebellen zwei ballistische
Raketen in Richtung des Ben-Gurion-Flughafens in der Nähe von Tel Aviv
abgefeuert. Zudem habe man den US-Flugzeugträger »Harry S. Truman« mit
Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen. In Tel Aviv,
Jerusalem und anderen Teilen Israels heulten demnach die Alarmsirenen.
Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen hatten nach
US-amerikanischen Angriffen auf Ziele im Jemen eine Eskalation ihrer
Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und in Israel angekündigt. Das
israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Rakete über
israelischem Territorium abgefangen.
——
8. IPG: Nach Assads Sturz ringt Syrien um seine Zukunft und Souveränität –
im Schatten der Regionalmächte und eines Kampfes der Narrative.
https://www.ipg-journal.de/regionen/naher-osten/artikel/the-devil-we-knew-8186/?utm_campaign=de_40_20250325&utm_medium=email&utm_source=newsletter
Naher Osten/Nordafrika
25.03.2025 |
Marcus Schneider <https://www.ipg-journal.de/ipg/autorinnen-und-autoren/autor/marcus-schneider/>
The devil we knew
Nach Assads Sturz ringt Syrien um seine Zukunft und Souveränität –
im Schatten der Regionalmächte und eines Kampfes der Narrative.
Marcus Schneider leitet das FES-Regionalprojekt für Frieden und
Sicherheit im Mittleren Osten mit Sitz in Beirut, Libanon. Zuvor war
er für die FES unter anderem als Leiter der Büros in Botswana und
Madagaskar tätig.
Noch nicht einmal vier Monate sind vergangen seit dem Sturz Baschar
al-Assads in Syrien. Der Untergang des Baath-Regimes nach über 50
Jahren markiert für den Nahen Osten ein monumentales geopolitisches
Ereignis, das die Regionalpolitik neu aufmischt.
Doch die neue Regierung steht vor gewaltigen Herausforderungen. Dabei
geht es keineswegs nur um die Fähigkeiten des neuen
Interimspräsidenten Ahmed al-Sharaa, sein zerrissenes Land über alle
politischen und konfessionellen Grenzen hinweg zusammenzuführen.
Viele, womöglich zu viele externe Akteure haben ein handfestes
Interesse daran, dass Syrien scheitert.
In einer seltsamen Ironie der Geschichte knickte dieses blutrünstigste
aller arabischen Regime im Dezember letzten Jahres fast lautlos weg.
„Assad oder wir verbrennen das Land“ – diese grausame Drohung
schleuderten seine Anhänger dem rebellierenden syrischen Volk einst
entgegen.
Hunderttausende wurden ermordet, Millionen vertrieben – um den Klan an
der Macht zu halten. Und doch war zuletzt kein einziger Soldat mehr
bereit, auch nur einen Schuss für den Diktator abzugeben.
Iran raus, Türkei rein – prägnanter lässt sich der geopolitische
Wandel in Damaskus nicht beschreiben.
Iran raus, Türkei rein – prägnanter lässt sich der geopolitische
Wandel in Damaskus nicht beschreiben. Syrien war für den Iran das
entscheidende Bindeglied seiner „Achse des Widerstands“, der über
Jahrzehnte einzige stabile staatliche Verbündete der isolierten
Mullahrepublik.
Dass Assad überhaupt bis 2024 überlebt hat, war allein dem Iran zu
verdanken. Dessen strategisches Mastermind Qasem Soleimani
organisierte die Hilfe durch Hisbollah und andere Milizen, die Syriens
Volksaufstand im Blut ertränkten. Diesmal allerdings brach das Regime
schneller zusammen, als der Iran reagieren konnte. Für Teheran ist es
die größte anzunehmende Katastrophe. 40 Jahre iranischer
Levantestrategie haben sich in Luft aufgelöst.
Die Hisbollah, einst Kronjuwel im Gefüge der iranischen
Vorwärtsverteidigung, sitzt nun im Libanon wie auf einer Insel fest,
ohne Hoffnung auf Nachschub und Wiederbewaffnung. In Damaskus
herrschen derweil die Salafisten – ob geläutert oder nicht, ist noch
unklar. Doch die neuen Machthaber machen keinen Hehl daraus, dass sie
den Iran als Feind betrachten – und ihm nicht vergeben wollen.
Dass ein arabisch-nationalistisches Regime überhaupt ein Bündnis mit
den ideologisch so gegensätzlichen persischen Islamisten eingehen
konnte, lag nicht allein am geteilten Antiimperialismus. Sondern auch
daran, dass das Assad-Regime, auch wenn es diesen Vorwurf stets von
sich wies, von vielen als „Alawitenregime“ wahrgenommen wurde.
Die Märzmassaker an der syrischen Küste, bei denen Milizen mit Nähe
zur neuen Regierung zahlreiche Angehörige dieser schiitischen
Minderheit abschlachteten, sind nicht nur Ausdruck eines fanatischen
Salafismus. Sie spiegeln auch tiefsitzende Ressentiments gegen eine
vormals als privilegiert wahrgenommene Gruppe wider.
Es gehört zur Tragödie der iranischen Revolution, dass sie die
innerislamische konfessionelle Scheidelinie nie überwand. In der
Region fand der Iran allein bei schiitischen Minderheiten dauerhaften
Rückhalt.
Das alawitisch dominierte Regime in Syrien gehörte dazu, inszenierte
sich Assad doch gerne als Schutzmacht der nicht-sunnitischen
Volksgruppen. Nun darf der Iran als Spoiler Nummer 1 für eine neue
Konsolidierung Syriens gelten. Teheran ist der natürliche Verbündete
jener Überreste der Assad-Armee, die sich nun im alawitischen
Küstenland neu organisiert. Ihr Angriff auf die Sicherheitskräfte des
Regimes ging den jüngsten Massakern voraus.
In einer bitteren Ironie der Geschichte teilen hier Teheran und sein
Erzfeind Israel ein Interesse. Beide setzen offensichtlich auf den
Zerfall Syriens unter Inkaufnahme eines neuen Bürgerkriegs.
Assads Fall war nur auf den ersten Blick ein Sieg für Israel, zumal
indirekte Folge des Enthauptungsschlags gegen die Hisbollah. Doch
Assad war the devilwe knew, das vertraute Übel. Syrien war innerhalb
der iranischen Achse nie ein Aktivposten. Der Diktator tat provokant
wenig, um der Hisbollah zu helfen, wirkte mit seinen Avancen Richtung
Golfstaaten eher wie ein Verräter an der Sache.
Schon vor dem Sturz Assads kontrollierte Israels Luftwaffe den
syrischen Luftraum. Doch erst nach seinem Abgang wurden Militärgerät
und Flugabwehr vollends ausgeschaltet. Offenbar fürchtet Israel die
neuen Machthaber, trotz ihrer zarten Avancen, mehr als Assad. Das
israelische Narrativ ist darauf ausgerichtet, das neue Syrien als
Todesgefahr für Minderheiten darzustellen. Ganz aktiv sucht Israel nun
nach Verbündeten unter Drusen und Kurden.
Es ist das Wiederaufleben der alten Peripherie-Doktrin, mit der
Tel-Aviv einst Allianzen suchte jenseits der sunnitisch-arabischen
Mehrheitsregime. Der jüdische Staat als Schutzmacht der Minderheiten –
das ist als Narrativ im Westen anschlussfähig sowohl auf rechts wie links.
Hiermit lässt sich die aktuelle Besetzung syrischen Territoriums an
der Grenze zu Israel rechtfertigen. Doch gerade ein übersteigerter
Konfessionalismus bedroht die Minderheiten – besonders s in Syrien, wo
Landkarten wenig über die konfessionelle Verteilung aussagen. Hier
wird der Hass gesät, der die konfessionelle „Flurbereinigung“ erst
möglich macht.
Nebenan wartet das multikonfessionelle Pulverfass Libanon nur darauf,
entzündet zu werden. Syrien ist das einzige arabische Land, mit dem
sich ein Abraham-Abkommen für Israel nicht lohnt. Der Preis wäre der
völkerrechtswidrig annektierte Golan, den niemand in Tel-Aviv zu
räumen bereit ist. Der Umsturz in Damaskus ist für Israel auch deshalb
ein Fall „vom Regen in die Traufe“, weil man statt des Iran plötzlich
die sehr viel potentere Türkei an den eigenen Grenzen wähnt.
Mit dem aufstrebenden 80-Millionen-Staat am Bosporus und seiner den
Muslimbrüdern anverwandten Regierung empfinden die sunnitischen Araber
im Maschrek weit mehr kulturell-politische Affinität als mit den
irrealen Glitzerwelten vom Golf oder dem klerikalen Regime in Teheran.
Für Erdoğans Türkei bietet das neue Syrien endlich die Möglichkeit,
innerhalb der arabischen Welt einen gleichgesinnten Staat zu installieren.
Für Erdoğans Türkei bietet das neue Syrien nach dem Scheitern in
Tunesien und Ägypten endlich die Möglichkeit, innerhalb der arabischen
Welt einen gleichgesinnten Staat zu installieren.
Es wäre nicht nur ein Triumph für neo-osmanische Träume, es würde
Ankara auch erlauben, in unmittelbarer Nähe zu Jerusalem als
Schutzherr der Palästinenser aufzutreten. Ein beispielloser
Prestigegewinn für ein Land, das nach seinem langen kemalistischen Weg
nach Westen die Führung der muslimischen Welt anstrebt. Dieses
Experiment birgt zwei Risiken.
Zum einen ist die siegreiche HTS-Milizunter Interimspräsident
al-Sharaa zwar pro-türkisch, sie stammt ideologisch jedoch aus dem
radikaleren Salafismus. Gerade diese Strömungen gaben sich in den
letzten Wochen der konfessionellen Gewalt hin.
Das Resultat könnte ein erneuter Bürgerkrieg sein oder ein Regime, das
international zum Paria wird. Zweitens ist es gerade die Nähe zur
Türkei, die die Spoiler antreibt. Niemand will in Damaskus einen
türkischen Satellitenstaat sehen. Je unabhängiger sich al-Sharaavon
Ankara machte, desto bekömmlicher würde er auch für die Gegner Erdoğans.
Denn auch die moderaten Araber blicken mit großem Misstrauen nach
Damaskus. Für sie ist das neue Syrien ein Spätprodukt des verhassten
arabischen Frühlings. Ob in Kairo, Amman, Riad oder Abu Dhabi: keinem
Herrscher ist daran gelegen, dass in Syrien eine Spielart des
politischen Islams reüssiert. Für Arabiens Potentaten gilt der
Islamismus als die größte Bedrohung ihrer Herrschaft. Aus Ägypten
kennt man das Drehbuch der Konterrevolution.
Auf Syrien lastet nicht nur die Geopolitik wie ein Albtraum – auch ein
Krieg der Narrative tobt. So marschiert die israelische Propaganda im
Gleichschritt mit dem Erzfeind aus Teheran.
Westliche Antiimperialisten, die den diskreditierten Assad zum
Bollwerk gegen Washington stilisierten, bilden eine unausgesprochene
Allianz mit MAGA-Ideologen, die Amerika im Kampf gegen den globalen
Islam wähnen. Liberale Skeptiker im Westen fühlen sich durch die
ausbrechende Gewalt an Syriens Küste in ihren Zweifeln bestätigt.
Dazwischen Moskau, gerade noch Verlierer, aber auch Meister der
Desinformation. Für die Russen bietet Syrien die Möglichkeit, bei
geringem eigenem Einsatz geopolitische Rivalen zu binden.
Die Rebellenoffensive im Spätherbst 2024 war ein seltenes Beispiel
rein syrischer Handlungsmacht. Der Zusammenbruch lief zu schnell.
Plötzlich wurden sie alle zu Zaungästen: Teheran und Moskau, ebenso
wie Tel-Aviv und Washington.
Selbst Ankara war überrascht. Doch dieser Moment ist vorbei. Das
Schicksal des Landes wird nicht nur unter Syrern ausgemacht. Doch die
Sterne stehen nicht günstig. Es gilt: Je besser die Befriedung und
Versöhnung im Innern gelingt, desto größer ist auch die Chance, sich
außenpolitisch freizuschwimmen. Niemand hätte einen solchen Erfolg
mehr verdient als das syrische Volk.
——
9. SZ: Gazakrieg - Deutschland macht es sich mit seinen Waffenlieferungen für Israel zu einfach
https://www.sueddeutsche.de/meinung/israel-deutschland-staatsraeson-kommentar-waffen-lux.UVdhH13aweUUeny646szfw
Meinung
Gazakrieg:
Deutschland macht es sich mit seinen Waffenlieferungen für Israel zu einfach
Kommentar von Bernd Dörries
25. März 2025, 15:20 Uhr
Angela Merkel und Olaf Scholz haben den Beistand für den jüdischen
Staat zur Staatsräson erklärt. Der Gedanke ist ehrenwert, entstammt
aber einer Epoche, aus der sich die Regierung in Jerusalem längst
verabschiedet hat.
Vor wenigen Tagen rief die Bundesregierung erneut Israel dazu auf, die
Angriffe auf Gaza zu beenden. Man sei „entsetzt“ über die zivilen
Opfer, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich und
Großbritannien.
Der Text schloss mit der Einsicht, dass „dieser Konflikt nicht durch
militärische Mittel gelöst werden“ könne. Konsequenzen wurden keine
angekündigt, Deutschland wird also weiter Israel mit jenen
Rüstungsgütern beliefern, die es braucht, um genau jenen Krieg zu
führen, den die Regierung mittlerweile für falsch und entsetzlich hält.
Im Oktober hatten sich Friedrich Merz und Olaf Scholz im Bundestag
sehr vehement dafür ausgesprochen, wieder mehr Rüstungsgüter zu
schicken, unter anderem die Getriebe für Merkava-Panzer – mit denen
israelische Truppen kurz zuvor die UN-Friedenstruppen in Südlibanon
angegriffen hatten, zwei Soldaten wurden von einem Wachturm
geschossen, auch Bundeswehrsoldaten befanden sich auf dem Gelände.
Im Bundestag spielte das keine Rolle. Die Debatte wirkte, als würden
sich die Vertreter der damaligen Ampel und der Union einen Wettkampf
liefern, wer der eifrigste Verfechter angeblicher deutscher
Staatsräson ist, und wer deshalb am schnellsten Waffen liefern will.
Daran hat sich nichts geändert. Vergangene Woche beschoss ein
israelischer Panzer auch die wenigen in Gaza verbliebenen
UN-Mitarbeiter.
Im Grunde ist „Staatsräson“ kein demokratisches Konzept
Die Verteidigung der Existenz Israels nicht nur als
Selbstverständlichkeit zu nehmen, sondern zur Staatsräson erhöht zu
haben – das war eine sympathische Idee, in den Augen vieler sogar eine
zwingende: wie ein Eid, den man vor der Welt ablegt, das Versprechen,
aus der Geschichte gelernt zu haben. Wer wollte dem widersprechen?
Nun denn, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages formulierte es
2023 so: „In der liberalen und naturrechtlichen Denktradition steht
die Idee der Staatsräson im Gegensatz zur Idee des Rechts und des
Rechtsstaats.“
Mit anderen Worten, es ist im Grunde ein autoritäres Konzept, dessen
Prämissen nicht im demokratischen Diskurs entstehen, sondern
ausgerufen werden – zuerst von Rudolf Dressler, der 2005 als
Botschafter in Israel dessen Sicherheit zum „Teil unserer Staatsräson“
machte.
Kanzlerin Angela Merkel wiederholte die Worte 2008, Olaf Scholz tat
dies nach dem Terror der Hamas. Es klang damals richtig und ist heute
auch nicht völlig falsch. Eineinhalb Jahre später sieht man aber auch
die Gefahren: Staatsräson bedeutet vor allem wieder Waffenlieferungen.
Diese waren anfangs richtig, um Israel gegen die Hamas zu verteidigen.
Sie sind jetzt falsch, weil eine weitgehend rechtsextreme israelische
Regierung den Gazastreifen in Grund und Boden bombt – und sich der
wegen Korruption angeklagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nur
durch den endlosen Krieg an der Macht hält.
Palästinenser werden nicht gesehen als Frauen, Kinder, Sanitäter
Es ist ein Krieg, der sich nicht nur gegen die Hamas richtet, sondern
immer wieder auch gegen unschuldige Männer, Frauen, Kinder, gegen
Journalisten, und auch gegen die UN, das Völkerrecht, die Humanität.
Nur 18 Prozent der Deutschen finden diese Art dieser Kriegführung gut,
60 Prozent wollen nicht, dass weitere Waffen an Israel geliefert
werden. Auf diese Zweifel hat die Staatsräson keine Antwort. Viele
Deutsche ringen zwischen der historischen Verantwortung, die nie enden
kann, und der Gegenwart, die so verstörend ist.
Als Rudolf Dressler 2005 sprach, war Israel ein anderes Land. Heute
will es in seiner Mehrheit keine Zwei-Staaten-Lösung mehr. Die
Staatsräson kennt diese Wirklichkeit nicht, sie kann sich nicht
anpassen, sie stützt in erster Linie militärische Lösungen, keine
politischen. Letztere sind schwer, die Staatsräson ist bequem. Sie
verhindert unangenehme Fragen, begrenzt letztlich die Empathie auf
eine Seite.
Palästinenser existieren nur noch im Kontext von Terror, sie werden
nicht gesehen als Frauen, Kinder, als Sanitäter oder Lehrer.
Staatsräson ist auch die Verweigerung des Wissenwollens, was im
Westjordanland passiert, wo viele israelische Siedler sich in ihrer
Gewalt kaum von den Terroristen der Hamas unterscheiden.
Die Staatsräson ist ein Lernen aus der Geschichte, sie ist aber auch
ein Nichtdazulernen-Wollen, sie kann Israel nur als Opfer sehen. Die
Staatsräson soll Härte und Entschlossenheit demonstrieren, dass sich
der Holocaust nie wiederholen darf.
Sie führt aber schnell zu kalten Herzen, etwa dazu, dass in Erfurt
eine Ausstellung mit Kinderzeichnungen aus Gaza in städtischen Räumen
abgesagt wurde, weil sie als zu politisch gilt. Führt die Staatsräson
wirklich dazu, dass man Antisemitismus bekämpft und Israel tatsächlich
schützt?
Oder resultiert daraus vor allem ein deutsches Selbstgespräch? Warum
ist es eigentlich nicht deutsche Staatsräson, zu einer Friedenslösung
zu finden? Was Israels Sicherheit am meisten gewährleisten würde.
———
10. FAZ: Westjordanland : Israelische Polizei nimmt F.A.Z.-Korrespondenten fest
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/israel-polizei-nimmt-faz-korrespondenten-fest-110376768.html
Westjordanland : Israelische Polizei nimmt F.A.Z.-Korrespondenten fest
24.03.2025, 16:12
Christian Meier, unser Korrespondent in Israel, wurde am Freitag bei
Recherchen im Westjordanland festgenommen und erst nach mehreren
Stunden wieder freigelassen. Das Auswärtige Amt übt scharfe Kritik.
Der Korrespondent der F.A.Z. für Israel und die palästinensischen
Gebiete, Christian Meier, ist bei Recherchen im Westjordanland am
Freitag festgenommen und erst nach mehreren Stunden wieder
freigelassen worden.
Siedler hatten ihn und weitere Journalisten sowie eine Gruppe
israelischer Menschenrechtsaktivisten auf palästinensischem Privatland
an der Weiterfahrt gehindert. Videoaufnahmen zeigen, dass die Siedler
aus einem auch nach israelischem Recht illegalen „Außenposten“ sich
bedrohlich verhielten, während Meier und die übrigen Anwesenden passiv
blieben.
Die von der Gruppe gerufene israelische Polizei sicherte schließlich
die Weiterfahrt, nahm aber Meier und einen der Israelis fest, offenbar
auf Drängen der Siedler und ohne Befragung der übrigen Anwesenden.
Nach mehreren Stunden auf einer Polizeiwache wurde Meier unter der
Auflage entlassen, dass er fünfzehn Tage lang das Westjordanland nicht
betritt. Er unterzeichnete die Vereinbarung, gab aber zu Protokoll,
dass er die Auflage für inakzeptabel halte.
„Inakzeptabler und willkürlicher Eingriff“
Meier war am Rande des Jordantals unterwegs, um zu Übergriffen auf
palästinensische Hirten zu recherchieren. Es kommt immer wieder vor,
dass Israelis und Ausländer im Westjordanland aufgrund haltloser
Vorwürfe radikaler Siedler festgenommen werden.
Den Sicherheitsbehörden wird zudem vorgeworfen, dass sie mit Siedlern
kooperierten und Gewalt tolerierten. Dass Journalisten festgenommen
werden, ist indessen unüblich. Die Vereinigung der Auslandspresse in
Israel(FPA) reichte eine Beschwerde ein.
Die F.A.Z. bezeichnete den Vorfall als inakzeptablen und willkürlichen
Eingriff. Sie forderte die israelischen Behörden auf, die Arbeit von
Korrespondenten nicht zu behindern. Die Pressefreiheit müsse auch im
Westjordanland gewährleistet werden.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte mit: „Wir verurteilen die
vollkommen unbegründete und unrechtmäßige Festsetzung des deutschen
F.A.Z.-Journalisten Christian Meier durch israelische Siedler am
letzten Freitag auf das Schärfste. Solche willkürlichen Aktionen
verwischen die Grenze zwischen israelischen Siedlern und regulären
israelischen Sicherheitskräften immer weiter.
Unser Vertretungsbüro in Ramallah und unsere Botschaft in Tel Aviv
haben sofort mit der israelischen Polizei Kontakt aufgenommen und die
unverzügliche Freilassung von Herrn Meier eingefordert. Wir sind
erleichtert, dass er direkt am Freitag wieder freigelassen worden ist.
Die erzwungene Unterzeichnung einer Erklärung, wonach Herr Meier sich
verpflichtet, das Westjordanland in den nächsten zwei Wochen nicht
mehr zu betreten, ist ebenso rechtswidrig wie die Festsetzung selbst.
Dies werden wir auch gegenüber der israelischen Regierung
thematisieren.“
——
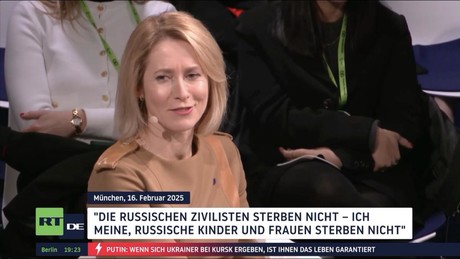








 Zerstörte Häuser nach einem israelischen Luftangriff auf den Stadtteil Shujaiya östlich von Gaza-Stadt am MontagOmar Ashtawy/APA (Ssreenshot)
Zerstörte Häuser nach einem israelischen Luftangriff auf den Stadtteil Shujaiya östlich von Gaza-Stadt am MontagOmar Ashtawy/APA (Ssreenshot)





 Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Revierfoto
Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Revierfoto